Instantkaffee: Gut oder schädlich
Schneller? Ja! Aber auch gesund?
Instantkaffee ist vielerorts beliebt.
In manchen Ländern macht es sogar 50% des gesamten Kaffeekonsums aus. Er lässt sich schneller und einfacher zubreiten und ist billiger als normaler Kaffee.
Normaler Kaffee wird mit Gesundheitsvorteilen in Verbindung gebracht, aber gelten diese auch für löslichen Kaffee? Genau das möchten wir heute herausfinden…
Was ist Instantkaffee
Instantkaffee ist ein Kaffee, der aus getrocknetem Kaffeeextrakt hergestellt wird.
Der Extrakt wird gewonnen, indem gemahlene Kaffeebohnen ähnlich wie beim normalen Kaffee gebräut werden, nur konzentrierter.
Nach dem Brühvorgang wird dem Extrakt das Wasser entzogen, damit sich ein Pulver oder Fragmente bilden, die sich bei der Zugabe von Wasser auflösen.
Antioxidantien und Nährstoffe von Instantkaffee
Kaffee ist eine der größten Antioxidantienquellen der modernen Ernährung.
Wie normaler Kaffee enthält auch Instantkaffee viele starke Antioxidantien.
Aufgrund der unterschiedlichen Verarbeitung enthält der Schnellkaffee lediglich ein leicht anderes Verhältnis an Antioxidantien. Weiterhin enthält eine Standardtasse Instantkaffee ohne Zusätze nur 4 Kalorien und nur geringe Mengen Kalium, Magnesium und Niacin.
Instantkaffee enthält weniger Koffein
Koffein ist das am häufigsten konsumierte Stimulans der Welt.
Eine Tasse löslicher Kaffee enthält zwischen 30 und 90 mg Koffein, während eine Tasse normaler Kaffee 70 bis 140 mg enthält.
Für diejenigen, die empfindlich auf so viel Koffein reagieren, könnte Instantkaffee also die bessere Wahl sein. Dieser ist auch als entkoffeinierter Kaffee erhältlich.
Zu viel Koffein kann zu Schlafstörungen, Magenverstimmungen, Zittern und einem erhöhten Herzschlag führen.
Instantkaffee enthält mehr Acrylamid
Acryladmid ist eine potenziell schädliche Chemikalie, die sich bildet, wenn Kaffeebohnen geröstet werden.
Die Chemikalie ist auch in anderen Lebensmitteln, Haushaltswaren und Körperpflegeprodukten zu finden.
Interessanterweise enthält Instant-Kaffee doppelt so viel Arcylamid wie frischer Röstkaffee.
Acrylamid kann mit der Zeit das Nervensystem schädigen und das Krebsrisiko erhöhen. Dennoch enthält Instantkaffee nicht genug Acrylamid, dass du dir Sorgen machen musst, außer du trinkst täglich literweise Instantkaffee.
Gesundheitliche Vorteile von löslichem Kaffee
Wie Röstkaffee wird auch die lösliche Variante mit verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht:
- Verbesserung der Gehirnfunktion
- Steigerung des Stoffwechsels
- Verbesserung der Lebergesundheit
- Senkung des Krankheitsrisikos (neurodegenerative Krankheiten)
- Verbesserung der psychischen Gesundheit
Instantkaffee gut oder schädlich?
Fazit: Der lösliche Kaffee ist nicht gesünder oder schädlicher als normaler Kaffee auch. Es sind wie immer die Extras, die deinen Kaffee gesund oder ungesund machen. Sahne, Zucker & Co. können aus einem ansonsten gesunden Getränk schnell eine ungesunde Kalorienbombe machen.
Die Vorteile von Instantkaffee liegen auf der Hand: Es lässt sich schneller und einfacher zubereiten und du benötigst keine Kaffeemaschine. Was den Geschmack angeht, bevorzugen die meisten Menschen Röstkaffee. Vom gesundheitlichen Standpunkt bleibt es aber dir überlassen, was du lieber trinkst.
Hier 8 gesunde Zutaten mit denen du deinen Kaffee verfeiner kannst.
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
Das SCHLIMMSTE Lebensmittel für Deine Gelenke, Haut und Blutzucker.
Filterkaffee: Warnung vor Acrylamid
Kaffee ist beliebt: In Deutschland trinkt jeder durchschnittlich 165 Liter Filterkaffee pro Jahr. Damit liegt Kaffee vor Mineralwasser (140 Liter) und Bier (107 Liter). Doch der Genuss bestimmter Kaffeesorten könnte womöglich unerwünschte Nebenwirkungen haben: In einer Untersuchung von Markt liegen vier von acht Proben über dem Signalwert für Acrylamid von 2010. Der Stoff steht im Verdacht, krebserregend und erbgutschädigend zu sein. Beim Überschreiten des Signalwerts mussten die Überwachungsbehörden der Länder die Hersteller darauf hinweisen, den Acrylamidwert im Kaffee zu senken. Seit 2011 gilt für Acrylamid ein höherer europäischer Richtwert.
Wie viel Acrylamid steckt in Filterkaffee?
Markt hat den Acrylamid-Gehalt von acht Kaffees untersuchen lassen.
Die Jacobs Auslese (Mitte) findet der Experte auffällig dunkel. Er vermutet, dass die Bohnen zeitsparend bei hoher Hitze geröstet wurden.
Beim schnellen Rösten mit bis zu 400 Grad kann das möglicherweise krebserregende Acrylamid entstehen.
In der Stichprobe enthält Eduscho Gala Nr. 1 am meisten Acrylamid: 431 Mikrogramm pro Kilogramm. Das entspricht .
. circa drei Mikrogramm Acrylamid pro Tasse. Die Verbraucherzentrale rät, die Aufnahme von Acrylamid zu minimieren.
Auch die Qualität des Kaffees wird von Experten bemängelt. In einer Probe Rohkaffee eines Herstellers finden sie Stöcke, Fehlbohnen, leere Hüllen und altes Fruchtfleisch von der Kaffeekirsche.
In einer anderen Probe befindet sich ein Stück Holz, vermutlich von einem Kaffeebaum. Das ist nicht verboten, aber die Qualität leidet darunter.
Acrylamid entsteht durch kurzes, heißes Rösten
Werden Lebensmittel wie Pommes Frites, Chips oder Kaffeebohnen über 170 Grad erhitzt, kann sich Acrylamid bilden. Je kürzer das Erhitzen und je höher die Temperatur, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Acrylamid entsteht. In Industrieröstereien werden Kaffeebohnen oft nur zwei Minuten bei 400 Grad erhitzt. Für Hersteller ist das kostengünstiger, als die Bohnen längere Zeit bei niedriger Hitze zu rösten.
Vier Kaffees überschreiten deutschen Signalwert von 2010
In der Stichprobe überschreiten die Filterkaffees Eduscho Gala Nr. 1, Tchibo Feine Milde, Jacobs Krönung und Jacobs Auslese zum Teil deutlich den Signalwert von 280 Mikrogramm pro Kilogramm, der bis 2010 in der Bundesrepublik galt. Seit 2011 gibt es für Acrylamid einen einheitlichen europäischen Richtwert von 450 Mikrogramm pro Kilogramm, der in keinem der untersuchten Filterkaffees überschritten wird.
Krebsgefahr: Acrylamid in Lebensmitteln minimieren
Verbraucherschützer wie Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg sind dennoch alarmiert: "Acrylamid ist ein Schadstoff, der in Tierversuchen eindeutig krebserregend und erbgutschädigend ist." Um eine Gefahr für den Menschen auszuschließen, müsse man den Gehalt von Acrylamid in Nahrungsmitteln minimieren.
Bereits seit 2002 seien Hersteller aufgefordert, den Acrylamidgehalt in Lebensmitteln möglichst gering zu halten. Doch der 2011 eingeführte, rund 60 Prozent höhere europäische Richtwert widerspreche dem Minimierungskonzept: "Das bedeutet eine höhere Acrylamidbelastung für die Verbraucher in Deutschland", sagt Armin Valet.
Das sagen die Kaffeehersteller
Auf Anfrage von Markt schreiben die Hersteller, dass sie sich an die europäischen Richtwerte halten. Jacobs hält eine Verringerung des Acrylamidgehalts "ohne Auswirkungen auf Geschmack und Qualität" für nicht möglich. Dem Kaffeeröster Tchibo, der auch den Eduscho-Kaffee herstellt, sind nach eigenen Angaben "nur sehr begrenzte Minimierungsmöglichkeiten bekannt". Dass es auch anders geht, zeigen Dallmayr und Melitta. Ihre Kaffees enthalten weniger als die Hälfte Acrylamid, verglichen mit den anderen Kaffees der Stichprobe. Auch Aldi und Mövenpick haben niedrige Acrylamid-Werte.
Verbraucher bezahlen Wasser im Kaffee mit
Nach dem Rösten werden Kaffeebohnen mit Wasser abgekühlt. Davon bleibt einiges im Filterkaffee: In der Stichprobe lagen die Kaffees von Aldi, Jacobs Auslese und Mövenpick nur knapp unter dem gesetzlichen Grenzwert von fünf Prozent Wasser. Verbraucher bezahlen das Wasser mit - bei Mövenpick zum Beispiel 32 Cent pro Packung. In kleinen Röstereien wird Kaffee häufig noch an der Luft gekühlt. Das dauert länger und ist somit teurer, dafür enthalten luftgekühlte Kaffeebohnen in der Regel nur ein bis zwei Prozent Restwasser.
Die Hersteller schreiben, dass sie sich an die "Kaffeeverordnung" halten. Zudem sei es eine "gängige Praxis in der Kaffeewirtschaft". Mövenpick erklärt, man kühle "mit Hilfe der Umgebungsluft".
Dieses Thema im Programm:
Markt | 09.02.2015 | 20:15 Uhr
Mehr Ratgeber
Klosterküche: "Paradies" in Kloster Nütschau
Ausflugstipp: Gut Emckendorf
Das richtige Futterhäuschen im Winter
Lebensmittel
Günstige Kaschmir-Pullover im Test
Zimtsterne: Was steckt im Weihnachtsgebäck?
Alexa im Selbstversuch: Einkaufen
Handwerker-Pfusch: Mängel richtig reklamieren
Erpressungsfall: Pakete sorgfältig prüfen
Newsletter: Alle Themen, Tipps und Videos
Per E-Mail informiert Moderator Jo Hiller über die Themen von Markt. mehr
Für den Ernstfall richtig vorsorgen
Rechtliche Sicherheit, wenn man selbst nicht mehr entscheiden kann. mehr
Kaffee: 16 Instantprodukte auf dem Prüfstand - Kaum Schadstoffe, wenig Geschmack
- Instantprodukte auf dem Prüfstand
 Das Magazin ''Konsument'' testete in seiner aktuellen Ausgabe 14 lösliche Kaffees und zwei Kaffeeersatzgetränke auf ihren Schadstoffgehalt und die sensorischen Eigenschaften. Alle Pulver waren wenig belastet, eine Ausnahme machte das Produkt Caro von Nestlé, bei dem der Acrylamid-Gehalt am höchsten war. Geschmacklich stellten die Granulate weniger zufrieden, die meisten waren geschmacklich eher Durchschnitt.
Das Magazin ''Konsument'' testete in seiner aktuellen Ausgabe 14 lösliche Kaffees und zwei Kaffeeersatzgetränke auf ihren Schadstoffgehalt und die sensorischen Eigenschaften. Alle Pulver waren wenig belastet, eine Ausnahme machte das Produkt Caro von Nestlé, bei dem der Acrylamid-Gehalt am höchsten war. Geschmacklich stellten die Granulate weniger zufrieden, die meisten waren geschmacklich eher Durchschnitt.
Instantkaffee ist immer dort von Vorteil, wo es keine Kaffeemaschine, aber heißes Wasser gibt. Bevor der Krümel-Kaffee in die Tasse kommt, hat er einen langen Weg und ein aufwenndiges Herstellungsprozedere hinter sich. In diesen Prozess können sich an verschiedenen Stellen auch Schadstoffe einschleichen, etwa beim Rösten der Bohnen oder auch des Getreides. Hier kann sich der krebserregende und die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigende Stoff Acrylamid bilden. Und schon vor dem Rösten ist der Kaffee anfällig für Schadstoffe, unter anderem für Ochratoxin, ein Schimmelpilzgift, das laut ''Konsument'' nierenschädigend und mutmaßlich auch krebserregend ist. Außer dem Kaffeeersatz Nestlé Caro waren die Proben nur sehr wenig mit Acrylamid belastet. Aber auch hier bleibt man laut Test mit einer Tasse weit unter der von der WHO festgelegten Aufnahmedosis, die täglich nicht überschritten werden sollte. Ochratoxin wurde kaum gefunden. Alle Proben blieben weit unter dem Grenzwert, selbst der Tchibo Feine Milde, der mit 2 Mikrogramm pro Kilogramm den höchsten Anteil hatte.
Sensorisch, also bei Geruch und Geschmack, stachen zwei Produkte positiv heraus: Der Café Hag Löslicher Kaffee und der Caffait Gold. Allerdings rochen und schmeckten diese nur ''gut'', alle anderen schnitten hier durchschnittlich ab. Das meiste Koffein fand sich übrigens im GranArom Kaffee kräftig von Lidl, wer einen starken Wachmacher braucht, sollte also zu diesem, mit 1,50 Euro pro 100 Gramm auch günstigen, Instantkaffee greifen.
Den kompletten Testbericht lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ''Konsument''. Eine Übersicht über die getesteten Instant-Kaffees sowie ein kurzes Testfazit finden Sie hier, die Kaffee-Ersatzgetränke hier.
Kaffee: 31 Marken im Test

Von 31 Kaffees im Test haben wir 20 mit „gut“ bewertet. Andere schmeckten modrig-muffig oder nach feuchter Pappe.
Die noblen Namen verheißen einen besonderen Genuss, zum Beispiel „Meisterröstung“ von Jacobs, „Der Himmlische“ von Mövenpick oder „Gourmet Cafè“ von Eilles. Doch einen einzigartigen Kaffee sollte der Verbraucher deshalb noch lange nicht erwarten. Denn 21 der 31 geprüften Kaffees unterscheiden sich im Aroma nicht signifikant. Das ist das erstaunliche Fazit unserer sensorischen Untersuchung. Dafür haben sieben trainierte Kaffeeprüfer alle Kaffees verkostet und in Aussehen, Geruch, Geschmack und Mundgefühl systematisch beschrieben. Die Kaffees wurden sowohl in einer Kaffeemaschine als auch in einer Kolbenkanne aus Glas (siehe Abbildung) zubereitet.
Überwiegend Einheitsgeschmack

Rohe Kaffeebohnen sind grün-grau (links) und kaum aromatisch. Sie kommen getrocknet nach Deutschland, wo sie weiterverarbeitet werden. Geröstete Bohnen werden in Deutschland nur noch selten als ganze Bohnen verkauft. Etwa 90 Prozent gehen gemahlen in den Handel.
Der Kaffeebranche ist es gelungen, mit ihren Premiummarken im nichtmilden Segment den Geschmacksnerv der deutschen Verbraucher genau zu treffen. Die meisten Röstkaffees haben ein kräftiges, komplexes Aroma, eine deutliche Röstnote, schmecken deutlich säuerlich und bitter. Diesen einheitlichen Geschmack haben wir bei zwei Drittel der Kaffees festgestellt – unabhängig davon, ob es sich um etablierte Marken handelt, um preisgünstige Discounterware oder Handelsmarken, um Bio- oder Transfair-Kaffee. Sie alle hatten keinen Fehler in Geruch und Geschmack, wir beurteilten sie daher sensorisch mit „gut“. Das gilt für die Zubereitung in der Kaffeemaschine ebenso wie für den Aufguss in der Kolbenkanne.
Das sensorische Einheitsprofil der Kaffees im Test mag Kaffeegourmets nicht schmecken. Sie zahlen viel Geld für Kaffee einer bestimmten Herkunft und Sorte. Doch solche Spezialitätenröstungen haben mit dem Alltagskaffee von heute wenig gemeinsam. Handelsübliche Kaffees orientieren sich gezielt am populären Geschmack.
Drei sind „mangelhaft“

Mit einer solchen Kolbenkanne haben wir die Kaffees zubereitet und auch mit einer haushaltsüblichen Kaffeemaschine.
Allen Bemühungen zum Trotz treten dennoch Fehler auf. A & P von Kaiser’s Tengelmann, Tip Gold von Metro und Gran Cafe von Tchibo rochen und schmeckten bei beiden Zubereitungsarten modrig-muffig – ein gravierender Fehler. Tchibo, neben Kraft Foods der größte Kaffeeröster in Deutschland, konnte auch mit seinem zweiten Kaffee im Test nicht landen. Die Traditionsmarke Eduscho Gala Nr. 1 schmeckte zwar unauffällig aus der Kolbenkanne, aus der Kaffeemaschine aber ebenfalls modrig-muffig. Umgekehrt war es bei Fairglobe Café del Mundo von Lidl und Green Change von Tempelmann: Beide Bio-und Fairtrade-Kaffees schmeckten nur aus der Kolbenkanne nach feuchter Pappe.
Woher diese Fehler rühren, wissen wir nicht. Fest steht: Die Produktionskette vom Strauch bis zur Tasse ist lang – ernten, trocknen, sortieren, lagern, transportieren, rösten, mahlen, verpacken, verkaufen.
Mehr Arabica als Robusta
Die meisten Kaffees im Test sind als „100 % Arabica“ deklariert. Diese Sorte wächst in einer Höhe ab 600 Meter, ab 1 000 Meter wird sie auch Hochlandkaffee genannt. Anbau und Ernte sind aufwendig, sodass Arabica teuer gehandelt wird. Er deckt 60 Prozent des Kaffeemarkts ab und zeichnet sich durch ein mildes Aroma und eine leichte Säure aus. Immer dann, wenn ein Kaffee als reiner Arabica bezeichnet wurde, haben wir das im Labor überprüft. Kein Anbieter hat hier geschummelt. Interessant: Diese Kaffees gehören meist zu den „Guten“ im Test.
Reinen Robusta-Kaffee lobt dagegen kein Hersteller aus. Die zweitwichtigste Kaffeesorte wird auf dem Etikett allenfalls in Mischungen erwähnt. Dabei stellen Robusta-Bohnen bereits 40 Prozent des Weltmarktes. Sie wachsen in den Tieflandtropen, sind herb-würzig, praktisch säurefrei, koffeinreicher und preiswerter als Arabica.
Der Kaffee wird meist gemischt



Fast alle Firmen mischen ihre Kaffees nicht nur aus Kosten- und Geschmacksgründen, sondern gleichen damit auch natürliche Qualitätsschwankungen beim Rohkaffee aus. Bohnen aus bis zu zehn unterschiedlichen Provenienzen (Herkünften) können in einem „Blend“ stecken. Zum Beispiel ist der untersuchte Café Aha von Gepa eine Komposition von Bohnen aus fünf Ländern – Costa Rica, Guatemala, Tansania, Bolivien und Nicaragua. Doch die Mischung allein macht es nicht. Spezielle Behandlungsverfahren mit Dampf können helfen, herkunftspezifische Geschmacksunterschiede und Aromafehler zu reduzieren.
Das Geschick des Rösters entscheidet
Wesentlich dafür, dass ein Markenkaffee stets gleich schmeckt, ist aber der Röstprozess. Der Röstmeister steuert die Aromabildung über Rösttemperatur und Röstdauer. Unter seiner Regie wird der Rohkaffee etwa auf 260 Grad Celsius erhitzt. In den Bohnen setzt eine Kaskade chemischer Reaktionen ein: Wasser verdampft, Zucker und Eiweiße reagieren miteinander, Öle treten aus, Säure zersetzt sich. Am Ende entstehen mehr als 800 Aromastoffe.
Viel Acrylamid in vier Kaffees

Wenn der Kaffee im Verarbeitungsland angekommen ist, werden zunächst stichprobenartige Kontrollen gemacht. Rund eine Million Tonnen Rohkaffee gelangt jährlich nach Deutschland. Etwa die Hälfte davon wird für den heimischen Markt verarbeitet, die andere Hälfte geht in den Export – oft auch als löslicher Kaffee.
In allen Lebensmitteln, die sowohl Zucker als auch die Aminosäure Asparagin enthalten, kann bei hohen Temperaturen unerwünschtes Acrylamid entstehen. Davon ist zwangsläufig auch Kaffee betroffen, der von Natur aus zu etwa 40 Prozent aus Kohlenhydraten (darunter auch Zucker) und zu etwa 10 Prozent aus Eiweiß (Aminosäuren) besteht. Im Tierversuch wirkt Acrylamid krebserregend, erbgut- und nervenschädigend. Beim Menschen ist bisher nur die Neurotoxizität belegt. In Deutschland bemüht man sich seit sechs Jahren, Acrylamid in Lebensmitteln zu reduzieren. Dafür berechnet das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit jährlich für verschiedene Produktgruppen jeweils einen Signalwert, der sich am Machbaren im Markt orientiert. Für Röstkaffee beträgt er derzeit 277 Mikrogramm je Kilogramm Kaffee. Bei der letzten Berechnung wurde dieses Ziel aber von etlichen Kaffees nicht erreicht. Da man den einmal erreichten Signalwert nicht lockern wollte, wurde ein Beobachtungswert von 310 Mikrogramm pro Kilogramm eingeführt. Dass sich Arcylamid minimieren lässt, zeigen viele Kaffees im Test. Nur vier fallen negativ auf: Penny/Contal und Alnatura liegen über dem Signalwert, Mona Gourmet und A & P überschreiten sogar den Beobachtungswert.
Kein Risiko durch Furan
Auch der flüchtige Aromastoff Furan entsteht unvermeidbar beim Rösten. Im Tierversuch wird Furan als krebserregend eingestuft, seine Wirkung beim Menschen ist noch unerforscht. Sicherheitshalber gilt auch hier: So wenig Furan wie möglich aufnehmen. Doch gerade Röstkaffee ist die größte Zufuhrquelle für Furan. Allerdings bedeutet viel Furan im Kaffeemehl nicht, dass auch viel Furan in der Kaffeetasse landet und umgekehrt. Erfreulich: Bei 24 Kaffees im Test konnten wir den Furangehalt nach der Zubereitung per Aufguss mindestens mit „gut“ bewerten, und kein Kaffee war schlechter als „befriedigend“. Das beruhigt einerseits, doch andererseits nimmt der Mensch Furan auch aus anderen erhitzten Lebensmitteln auf (Gemüse- und Fleischkonserven, Gläschennahrung, Brot).
Keine Gefahr durch Schimmelpilzgift
Vergleichsweise gut erforscht ist Ochratoxin A. Das Schimmelpilzgift kann auch im Kaffee vorkommen, wenn er feucht gelagert wurde. In großen Mengen kann Ochratoxin A beim Menschen das Immunsystem und die Nieren schädigen, im Tierversuch wirkt es krebserregend.
Im Test blieben alle Kaffees weit unter der gesetzlich zulässigen Höchstmenge von 5 Mikrogramm Ochratoxin A pro Kilogramm Kaffee. Den höchsten Gehalt fanden wir in Rondo Melange mit 1,5 Mikrogramm. Ein gesundheitliches Risiko braucht aber niemand zu befürchten. Dazu müsste ein 70 Kilogramm schwerer Erwachsener 840 Tassen Rondo Melange pro Woche trinken.
Der koffeinreichste Kaffee im Test
Eine erwünschte Substanz im Kaffee ist das Koffein. In der Natur schützt sich die Kaffeepflanze damit vor Fraßfeinden. Im menschlichen Körper wirkt Koffein anregend, am stärksten nach 20 bis 60 Minuten. Nicht alle Menschen vertragen Koffein gleichermaßen. In der Regel sind 0,3 Gramm Koffein am Tag aber unproblematisch. Die meisten Kaffees im Test enthalten 1,2 Gramm Koffein pro 100 Gramm Kaffeemehl. Von ihnen könnte man sich also etwa drei bis vier Tassen (je o,125 Liter) täglich gönnen. Auf die gleiche Koffeinmenge kommt man mit Jacobs Meisterröstung schon mit gut zwei Tassen. Sie ist mit 1,9 Gramm Koffein pro 100 Gramm der koffeinreichste Kaffee im Test – getreu der Werbung: „Der Kräftige, der dich aufbaut“.
Zu viel Koffein kann allerdings zu Unruhe oder Konzentrationsschwäche führen. Doch keine Sorge: Die tödliche Koffeindosis für einen Erwachsenen liegt bei unrealistischen 100 Tassen Kaffee am Tag.
Dieser Artikel ist hilfreich. 1405 Nutzer finden das hilfreich.
Navigation des Hauptbereiches
© Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum
Diese Seiten sind Ausdrucke aus www.krebsinformationsdienst.de, den Internetseiten des Krebsinformationsdienstes, Deutsches Krebsforschungszentrum. Mehr über den Krebsinformationsdienst und seine Angebote lesen Sie auf unseren Internetseiten. Am Telefon stehen wir Ihnen täglich von 8.00 bis 20.00 für Fragen zur Verfügung, unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 – 420 30 40. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de.
Bitte beachten Sie: Internet-Informationen sind nicht dazu geeignet, die persönliche Beratung mit behandelnden Ärzten oder gegebenenfalls weiteren Fachleuten zu ersetzen, wenn es um die Diagnose oder Therapie einer Krebserkrankung geht. Die vorliegenden Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung dieser Inhalte, unabhängig von Form, Zeit oder Medium bedarf der schriftlichen Zustimmung des Krebsinformationsdienstes, Deutsches Krebsforschungszentrum.
Ursprüngliche Adresse dieses Ausdrucks: https://www.krebsinformationsdienst.de

Kaffee und Krebsrisiko: Genuss oder Schaden?
Ohne den Milchkaffee am Morgen oder den Cappuccino am Nachmittag wäre für viele Menschen die Welt nicht in Ordnung. Doch Kaffee hatte lange einen schlechten Ruf: zu viel Koffein sei schädlich für die Nerven, zu viele Röststoffe nicht gut für den Magen. Kaffee sei schlecht für den Flüssigkeitshaushalt. Vor einigen Jahren fand man auch noch krebserregendes Acrylamid, das bei der Röstung entsteht. Umfragen zeigen: Viele gesundheitsbewusste Menschen verzichten auf das Getränk. Auch in Diätvorschlägen findet man oft den Tipp, den Konsum zumindest stark einzuschränken.
Doch ist das wirklich notwendig? Krebsforscher sagen nein. Studien zeigen: Solange man Kaffee nicht kochend heißt trinkt, ist er nicht schädlich und möglicherweise sogar ein regelrecht gesundes Getränk.
Was wirklich drin ist in der Tasse, erläutert der Krebsinformationsdienst in seinem Text "Kaffee und Krebsrisiko".
Inhaltsübersicht
Quellen und Links
Genutzte Quellen sind im Text nach Möglichkeit direkt verlinkt. Eine Auswahl genutzter Fachliteratur sowie Tipps zum Weiterlesen finden sich am Ende des Textes.
Auf den Lebensstil insgesamt achten
Kaffee – ob er gesund ist oder nicht, diese Frage hat schon manche Diskussion am Kaffeetisch ausgelöst. Heute geben Experten Entwarnung: Kaffee ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Krebs erregend. Er ist auch sonst bei weitem nicht so gesundheitsschädlich, wie viele Menschen glauben. Selbst die enthaltenen pflanzlichen Säuren sehen Wissenschaftler heute eher positiv. Nur allzu viel Koffein sollte es nicht sein, und man sollte Kaffee auch nicht brühend heiß trinken - das schadet den Schleimhäuten.
Gilt diese Aussage für alle Menschen? Leider nein: Wer bestimmte Erkrankungen hat, oder wer Medikamente einnimmt, die sich mit Kaffee nicht gut vertragen, kann sich schaden. Ob dies möglich ist, kommt jedoch ganz auf die individuelle Situation an. Daher sollte man im Zweifelsfall auch mit dem Hausarzt oder behandelnden Fachärzten Rücksprache halten - ein solches Gespräch lässt sich durch Informationen aus dem Internet nicht ersetzen.
Und es gibt noch ein weiteres Problem beim Blick in die Kaffeetasse, wie Statistiken zeigen: Unter den Menschen, die sehr viel Kaffee trinken, leben viele insgesamt nicht gesund. Wer viel Koffein braucht, schläft zum Beispiel schlecht oder zu wenig, raucht nicht selten auch und achtet insgesamt weniger auf einen gesunden Lebensstil.
Das Wichtigste in Kürze: Kaffee – gesund oder ungesund?
Lange galt Kaffee als ungesund. Heute weiß man: So stimmt das nicht, eher das Gegenteil ist der Fall. Gerade was die Frage nach dem Krebsrisiko angeht, gilt das Getränk inzwischen sogar eher als Schutz.
Studien zeigen: Kaffee ist kein Risikofaktor für die meisten häufigeren Krebsarten. Lungenkrebs, Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Eierstockkrebs entstehen bei Kaffeetrinkern nicht häufiger als bei "Kaffee-Abstinenzlern". Dies gilt jedoch immer nur dann, wenn man nicht zusätzlich raucht.
Im Juni 2016 kam sogar eine ganz offizielle "Entwarnung" von der Internationalen Krebsforschungsagentur (IARC): Ein Krebsrisiko durch Kaffee kann ausgeschlossen werden. Nur zu heiß sollte man ihn nicht trinken, um die Schleimhäute in Mund und Speiseröhre zu schonen. Doch dies gilt nicht nur für Kaffee, sondern für alle Getränke und Speisen.
Die Belege im Detail: Schutz vor Krebs statt Risiko?
Einen Überblick über aktuelles Wissen bietet der Krebsinformationsdienst unter "Krebsrisikofaktoren".
Was weiß man im Einzelnen über die gesundheitlichen Auswirkungen? Dazu gibt es inzwischen zahlreiche Studien:
Bereits aufgeführt wurden die Untersuchungen zu Prostatakrebs - Kaffee bietet mehr Schutz als Risiko, zumindest bei normalem Konsum.
Kaffee bietet Schutz vor Leberkrebs: Seine Inhaltsstoffe bremsen Veränderungen des Lebergewebes, die zur Entstehung von Karzinomen beitragen. Diese Aussage hat sich in vielen Studien bestätigt, auch wenn der Umfang der schützenden Wirkung (noch) nicht genau bezifferbar ist. Ob man Kaffee oder Extrakte daraus sogar gezielt zur Vorbeugung oder zur Behandlung von Leberkrebs einsetzen könnte, wird derzeit untersucht.
Kaffee scheint auch das Risiko zu senken, an Nierenkrebs und "schwarzem" wie "weißem" Hautkrebs zu erkranken. Und zumindest für Frauen vor den Wechseljahren gibt es vielleicht auch einen schwachen Schutzeffekt vor Brustkrebs. Ähnlich könnte es neuen Erkenntnissen zufolge auch bei Darmkrebs aussehen. Ausreichend belegt ist ein Zusammenhang außer für Leberkrebs bisher aber nur für Krebserkrankungen der Gebärmutter, sogenannte Endometriumkarzinome.
Möglicherweise existiert eine solche günstige Wirkung noch für weitere Tumorarten, hier ein Beispiel: Die Autoren einer aktuellen übergreifenden Analyse aller Daten gehen Ende 2017 davon aus: Auch Krebs in Mund und Rachen scheint bei Kaffeetrinkern seltener vorzukommen - zumindest so lange, wie sie nicht rauchen.
Ähnlich positive Effekte zeigen sich auch für eine Reihe von anderen Krankheiten. Weitere Forschung ist allerdings erforderlich.
Und was ist mit Blasenkrebs? Und Karzinomen der Speiseröhre?
Offen war lange Zeit die Frage nach dem Blasenkrebsrisiko: Zwar erkranken Vieltrinker, die mehr als zehn Tassen pro Tag konsumieren, tatsächlich häufiger. Dies ist jedoch nicht auf den Kaffeekonsum, sondern vermutlich auf den zusätzlichen Konsum von Zigaretten zurückzuführen. Neuere Studien machen dies recht deutlich.
Ein sehr hoher Kaffeekonsum bietet Forschern zudem oft Hinweise darauf, dass die betroffenen Probanden einen insgesamt nicht gesundheitsfördernden Lebensstil haben. Menschen, die sehr viel Kaffee trinken, rauchen nicht nur häufiger als andere. Sie trinken außerdem oft insgesamt viel zu wenig Flüssigkeit zu sich. Dies führt dazu, dass Schadstoffe, die über die Harnwege ausgeschieden werden, konzentrierter in die Blase gelangen und meist auch länger darin bleiben.
Auch chronische Infekte, die die Blasenschleimhaut schädigen, sind bei Menschen häufiger, die zu wenig trinken.
Unter Berücksichtigung solcher Einfussfaktoren konnten neuere Studienübersichten keinenen Zusammenhang zwischen Kaffee und Blasenkrebs feststellen.
Kaffee kann jedoch das Risiko für Speiseröhrenkrebs steigern – allerdings nur, wenn man ihn viel zu heiß trinkt. Auch andere zu heiße Getränke können schaden und zu einer chronischen Schädigung der Schleimhaut führen.
Wer mit saurem Aufstoßen oder Sodbrennen auf Kaffee oder andere Lebensmittel und Getränke reagiert, sollte beim Arzt die Ursache abklären lassen. In der Regel sind es nämlich nicht die im Kaffee enthaltenen Säuren, die dafür unmittelbar verantwortlich sind. Wichtig bei ständigem Sodbrennen ist baldige Abhilfe: Auf Dauer sind sonst Schädigungen der Schleimhaut möglich, und diese gelten als Krebsvorstufe.
Nicht alle Studien untereinander vergleichbar
In vielen Befragungen wurde gezählt, wie viele Tassen Kaffee die Studienteilnehmer am Tag tranken. Das Problem: Oft ist nicht genau angegeben, wie groß diese Tassen waren. Das erschwert die Vergleichbarkeit der Studien. Man kann daher nur schlecht in Zahlen angeben, wie "gesund" Kaffee genau ist. Die beste Wirkung schein Kaffee bei "durchschnittlichem" Konsum zu haben.
Bei der Aussagekraft vieler Studien zur Kaffeewirkung gibt es eine gewisse Einschränkung: So lassen sich nur wenige Untersuchungen unmittelbar untereinander vergleichen. Oft ist unklar, wie viel Kaffee die Probanden tatsächlich getrunken haben, weil die Angabe der Tassengröße fehlt. Manchmal sind auch die sonstigen Lebensumstände der "Vieltrinker" ungenau erfasst.
Daher lassen sich die Kaffeewirkung und vor allem der schützende Effekt bisher kaum in eindeutigen Zahlen und Prozenten angeben. Zumindest die Aussage, dass Kaffee für die meisten Tumorarten keinen Risikofaktor darstellt und vor Leberkrebs und Gebärmutterkörperkrebs schützen kann, gilt aber als gesichert.
Wenig weiß man darüber, welche Wirkungen Kaffee bei Menschen haben kann, die bereits an Krebs erkrankt sind. Zurzeit kann man nicht belegen, ob Kaffee bei ihnen tumorhemmend wirkt. Genauso wenig lässt sich beurteilen, ob Kaffee Rückfälle oder Metastasen fördern könnte.
Sicher ist dagegen: Die Inhaltsstoffe des Getränks, vom Koffein bis hin zu anderen Substanzen, vertragen sich mit vielen Medikamenten nicht besonders gut. Die Wirkung von Arzneimitteln kann verändert werden. Ihrerseits führen einige Medikamente dazu, dass die Koffeinwirkung viel länger anhält als gewohnt.
Kaffee als Getränk? Auf die gesamte tägliche Trinkmenge achten
Ist Kaffee ein "Flüssigkeitsräuber"? Auch hier gibt es eher eine Entwarnung: Mit der Flüssigkeitsbilanz sieht es bei Kaffeetrinkern nicht so schlecht aus, wie lange befürchtet.
Die Inhaltsstoffe wirken zwar "diuretisch": Sie regen den Körper zu vermehrter Ausscheidung von Wasser und Salzen über die Nieren an. Wer das Getränk regelmäßig konsumiert, gewöhnt sich allerdings bis zu einem gewissen Grad daran, die entwässernde Wirkung lässt nach. Kaffee darf also ruhig mitgezählt werden, wenn man die tägliche Trinkmenge abschätzt, so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
Trotzdem sollte man darauf achten, Kaffee nicht als Durstlöscher oder vorrangige Flüssigkeitsquelle zu nutzen. Dazu ist Wasser besser geeignet.
Andere gesundheitliche Aspekte hängen von der individuellen Situation ab: Ob Kaffee beispielsweise gegen Kopfschmerzen hilft oder vielmehr einen Migräneanfall fördert, ob Patienten mit Diabetes, Rheuma, Magen-Darm-Leiden, Gicht, Osteoporose oder sonstigen chronischen Erkrankungen Kaffee trinken dürfen, müssen Betroffene mit ihrem Arzt besprechen.
- Die gleiche Empfehlung gilt für Krebspatienten und -patientinnen: Die behandelnden Ärzte können zum Thema Kaffee beraten und auf mögliche Wechselwirkungen mit Medikamenten achten.
Hintergrund: Kaffee – Was kommt in die Tasse?
Nach Wasser ist Kaffee das weltweit am häufigsten konsumierte Getränk. Entsprechend kritisch wird seine Qualität zumindest in der Europäischen Union kontrolliert. Nur selten werden bei handelsüblichen Marken zu viele Schadstoffe gefunden, etwa das beim Rösten mit zu hoher Temperatur entstehende Acrylamid oder Spuren von Schimmelpilzgiften.
Ob aus einer Schadstoffbelastung von Kaffee ein messbares Krebsrisiko entstehen kann, ist anhand der derzeit vorliegenden Daten unklar bis unwahrscheinlich. In einer Übersichtsarbeit von 2011 zum Thema Acrylamid kommen Wissenschaftler beispielsweise zu dem Schluss: Acrylamid aus Kaffee und anderen Quellen erhöht das Krebsrisiko wohl nicht wesentlich. Unklar bleibt lediglich die Frage nach dem Risiko für Nierenkrebs.
Allerdings: Betrachtet man alle seine Inhaltsstoffe zusammen, scheint Kaffee auch vor Nierenkrebs eher zu schützen.
Koffein: Anregender Inhaltsstoff
Wie viel Koffein, wie viele pflanzliche Schutzstoffe sind in Kaffee enthalten? Das hängt von der Sorte und der Zubereitung ab.
Kaffeebohnen sind die Samen des Kaffeebaumes; für die Produktion wichtig sind die Arten Coffea arabica und Coffea canephora (Robusta) . Die getrockneten und vom Fruchtfleisch befreiten Samen werden geröstet. Erst dabei entstehen viele Substanzen, die Geschmack, Geruch und biologische Wirkung von Kaffee ausmachen. Die Forschung befasst sich intensiv mit allen davon.
Ein wesentlicher Inhaltsstoff ist Koffein. Dabei handelt es sich chemisch um ein sogenanntes Alkaloid aus der Gruppe der Methylxanthine. Dessen Wirkung wird generell als "anregend" bezeichnet: auf das Nervensystem, die Herzfrequenz, den Blutdruck, auf die Magenfunktion und die Darmtätigkeit sowie auf viele weitere Stoffwechselvorgänge.
Hinzu kommen Aroma- und Röststoffe. Vor allem Letztere entstehen ähnlich wie Karamell beim Erhitzen der in den Bohnen enthaltenen Zucker und Eiweiße.
Enthalten sind außerdem Mineralstoffe, Fettsäuren und ihre chemischen Verbindungen, pflanzliche Phenolsäuren wie etwa die Kaffeesäure, und sogar Vorstufen von B-Vitaminen. Was davon in der Tasse ankommt, hängt allerdings stark von der Aufbereitung des Rohkaffees und von der individuellen Art der Kaffeezubereitung ab.
Nicht nur das Koffein gilt als "bioaktiv". Auch von einem Teil der anderen heute bekannten Inhaltsstoffe kennt man eine oder mehrere Auswirkungen auf den Organismus.
Wie wirken die enthaltenen Substanzen? Wie wirkt Kaffee insgesamt?
Gehaltvolle Bohnen: Antioxidantien und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit
Auch wenn Kaffee als gesundheitsfördernd gilt: Eine gesunde Ernährung kann das Getränk nicht ersetzen.
Vor allem Inhaltsstoffe, die als sogenannte Antioxidantien wirken, werden heute auf ihre gesundheitliche Wirkung hin untersucht. Ihnen wird nachgesagt, dass sie sogenannte freie Radikale an ihrer schädigenden Wirkung auf die Zellstrukturen hindern und so beispielsweise Fehler an der Erbsubstanz DNA verhüten.
Von diesen pflanzlichen Substanzen und anderen, möglicherweise vor Krebs schützenden Stoffen findet sich in Kaffee eine ganze Menge, etwa die bereits erwähnten Phenolsäuren. Obwohl diese in isolierter Form und höherer Konzentration schädlich sein können - und früher zum schlechten Ruf von Kaffee beitrugen -, scheinen sie im Getränk selbst bei Menschen eher positiv zu wirken.
- Kaffee kann eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse auf keinen Fall ersetzen.
Doch der quantitative Beitrag von Kaffee zur Gesundheit ist nicht zu unterschätzen: U.S.-Studien zeigten, dass bei Amerikanern wichtige Stoffe für die Gesundheit bis zu einem Fünftel über Kaffee aufgenommen werden. Lediglich die Vitamine im Kaffee, etwa das Vitamin E, spielen für die tägliche Versorgung mengenmäßig praktisch keine Rolle.
Die Kritik an diesen Aussagen folgte allerdings gleich hinterher: Aus den entsprechenden Studien könne man keineswegs ablesen, wie wichtig das Getränk sei. Sichtbar werde vielmehr, wie wenig Obst und Gemüse der Durchschnittsamerikaner täglich verzehre, wenn die Zufuhr sogenannter sekundärer Pflanzenstoffe hauptsächlich über Kaffee erfolge.
Noch mehr drin in der Tasse
Es gibt Hinweise darauf, dass Kaffee auch in den Energiestoffwechsel eingreift: Der Konsum wirkt sich unter anderem regulierend auf die Insulinwirkung aus. Die Regelkreise, in die das Hormon Insulin eingebunden ist, beeinflussen nicht nur den Zuckerstoffwechsel, sondern auch die Erneuerung von Geweben und Zellen.
Dies hört sich zwar zunächst positiv an. Man geht aber heute davon aus, dass entsprechende Botenstoffe und Wachstumsfaktoren auch das Wachstum von Tumorgewebe anregen könnte, vor allem bei Menschen, die deutlich zu viel wiegen: Ihr Körper spricht häufig nicht mehr so gut auf das Hormon Insulin an, was zum Beispiel zur Zuckerkrankheit (Diabetes) führen kann. Diese chronische Stoffwechselschieflage, das sogenannte metabolische Syndrom, steigert nach neueren Erkenntnissen auch das Krebsrisiko.
Kaffee scheint allen diesen Prozessen entgegen zu wirken. Die risikomindernde Wirkung ist bei Menschen mit starkem Übergewicht am deutlichsten ausgeprägt.
Lange nahm man an, dass vor allem das Koffein für diese krebsschützende Wirkung bei übergewichtigen Kaffeetrinkern verantwortlich sei. Für das Koffein spricht, dass laut einiger Studien die Schutzwirkung ausbleibt, wenn Menschen nur koffeinfreien Kaffee trinken.
Neuere Studien deuten allerdings auch auf eine Wirkung anderer pflanzlicher Schutzstoffe hin. Sie wurden im Einzelnen noch nicht identifiziert.
Dies schließen Forscher aus Vergleichen zwischen Kaffee- und Teekonsumenten: Frauen, die vier Tassen Kaffee und mehr pro Tag trinken, haben laut einer großen Studie ein geringeres Risiko für Krebs der Gebärmutterschleimhaut (Endometriumkarzinom), eine der Krebserkrankungen, die unter anderem durch Übergewicht gefördert wird.
Bei Teetrinkerinnen, die oft die gleiche Menge an Koffein oder anderen Methylxanthinen wie Kaffeetrinkerinnen aufnehmen, findet sich ein solcher Schutzeffekt nicht. Also müssen außer Koffein weitere Stoffe dafür verantwortlich sein, die tatsächlich nur in Kaffee vorkommen.
Lebensqualität: Wie viel Kaffee darf es sein? Was gilt für Krebspatienten?
Wie viel Kaffee darf man trinken? Das hängt vom persönlichen Gesundheitszustand ab. Manche Menschen vertragen mehr, manche weniger. Der Hausarzt kann Auskunft geben. Anhaltspunkte bietet das Bundesinstitut für Risikobewertung unter www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_koffein_und_
Medikamente sollten nicht mit Kaffee eingenommen werden, außer der Arzt hat es ausdrücklich erlaubt.
Dies gilt auch für Krebspatienten: Die Aufnahme der Wirkstoffe im Magen und im weiteren Verdauungstrakt könnte behindert werden. Manche Mittel verstärken ihrerseits die Koffeinwirkung. Welche Wirkung die Inhaltsstoffe von Kaffee auf Menschen haben, die regelmäßig Medikamente einnehmen, ist seit einiger Zeit sogar ein wichtiges Forschungsthema. Dies zeigt ein Blick in internationale Studienregister.
Mehr zu möglichen Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln, Getränken und Lebensmitteln hat der Krebsinformationsdienst in einem eigenen Text zusammengestellt.
Den meisten Menschen ist nicht nur der Kaffeegenuss als solcher wichtig: Sie schätzen vor allem die anregende Wirkung des Koffeins. Dabei ist die Dosis wichtig: Viel hilft bei Kaffee nicht automatisch viel, wenn man wach bleiben möchte. Fachleute empfehlen, lieber öfter kleinere Mengen zu trinken als mehrere große Tassen auf einmal.
Wann der richtige Zeitpunkt für die letzte Tasse Kaffee des Tages ist, um gut schlafen zu können, hängt vom individuellen körperlichen Zustand ab. Auch das Alter und sogar die Gene spielen eine Rolle dabei, wie man auf Kaffee und das enthaltene Koffein reagiert. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät daher auch dazu, den persönlichen Gesundheitszustand zu berücksichtigen.
Etwas anderes sind sogenannte Energy Drings, die nicht nur gewisse Mengen Koffein, sondern meist auch viel Zucker und andere angebliche "Fitmacher" enthalten. Sie sind keine Durstlöscher, und sie sollten auf keinen Fall in größeren Mengen getrunken werden. Sie können Flüssigkeitsmangel überdecken und, gerade zusammen mit Alkohol, zu einer Überschätzung der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit führen.
Tee, andere koffeinhaltige Getränke: Wie verträglich sind sie?
Sie interessieren sich für die Wirkung von Grüntee? Lesen Sie hier mehr zu den Wechselwirkungen insbesondere von Matcha-Tee mit Medikamenten.
Viele Menschen gehen davon aus, dass Tee gesünder als Kaffee sei. Besondere Wirkungen werden vor allem dem sogenannten grünen Tee zugeschrieben, der aus unfermentierten, direkt nach dem Pflücken weiterverarbeiteten Teeblättern hergestellt wird. Doch was ist wirklich dran?
Auch hier gilt: Pauschale Aussagen lassen sich kaum treffen. Werden bei Kaffee meist die Risiken überschätzt, sind es bei Schwarz- oder Grüntee die vermutlich zu hoch angesetzten Hoffnungen auf eine positive gesundheitliche Wirkung.
Beim Grüntee sind sich die Forscher weitgehend einig: Zwar gibt es eine Vielzahl von Hinweisen auf gesundheitsfördernde Effekte des sogenannten Epigallocatechingallats (EGCG). Der Gehalt an dieser Substanz ist in Grüntee besonders hoch. Auch die Senkung des Krebsrisikos durch diesen Stoff wird diskutiert. Doch noch ist viel mehr Forschung notwendig. Einen anerkannten Stellenwert in der gesundheitlichen Vorbeugung oder der Behandlung von Krebs haben Grüntee-Extrakte nicht.
Zum Weiterlesen: Linktipps und Quellen (Auswahl)
Welche Rolle ganz allgemein der Lebensstil und die Ernährung für Gesunde und für Krebspatienten spielen, hat der Krebsinformationsdienst in folgenden Texten zusammengestellt:
Hintergrundinformationen bietet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Wie viel Kaffee gesund ist, wird unter anderem in einem Faltblatt zum "Richtig Trinken - fit bleiben erläutert. Das Infoblatt ist online abrufbar unter www.dge.de/presse/pm/richtig-trinken-fit-bleiben/.
Das Bundeszentrum für Ernährung informiert auf seinen Internetseiten in vielen Einzeltexten zu Kaffee, Tee und anderen koffeinhaltigen Getränken, hier ein Beispiel zur unbedenklichen Menge: www.bzfe.de/inhalt/pressemeldung-7620.html.
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit koordiniert gemeinsam mit den Bundesländern die Überwachungsprogramme für Lebensmittel. Ein Beispiel ist die regelmäßige Prüfung von Stichproben importierter Produkte wie Kaffee, mehr unter www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/02_AmtlicheLebensmittelueberwachung/lm_AmtLMUeberwachung_node.html.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat anlässlich der Risikobewertung der Internationalen Krebsforschungsagentur einen Text zu Kaffee online gestellt: www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2016/22/was_alles_so_drin_ist_im_muntermacher__kaffee_ist_eine_herausforderung_fuer_die_risikobewertung-197733.html. Über aktuelle Hinweise zu Schadstoffen oder Verunreinigungen in Lebensmitteln informiert das BfR ebenfalls: Am einfachsten ist die Suche, wenn man die Stichworte "Kaffee" oder auch "Tee" in die Suchmaschine der Seite eingibt. Wegen der Risiken der Überdosierung hat das BfR zudem besondere Informationen zu Erfrischungsgetränken und sogenannten Energy-Drinks mit sehr hohem Koffeingehalt zusammengestellt.
Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit befasst sich mit Kaffee, Koffein oder auch Schadstoffen wie Acrylamid in Kaffee. Eine Risikobewertung von Koffein ist 2015 erschienen, mehr unter www.efsa.europa.eu/de/press/news/150527.
Literatur für Interessierte und Fachkreise (Auswahl)
International Agency for Research on Cancer: Im Juni 2016 sorgte eine aktuelle Bewertung von Kaffee durch die Internationalen Krebsforschungsagentur für viel Medienaufmerksamkeit, mehr unter http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2016/pdfs/pr244_E.pdf. Der abschließende Bericht liegt bisher als Publikation vor, noch nicht als endgültige Monographie:
Loomis D, Guyton KZ, Grosse Y, Lauby-Secretan B, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, Guha N, Mattock H, Straif K (2016): Carcinogenity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. The Lancet Oncology, 15.6.2016, doi:10.1016/S1470-2045(16)30239-X.
Continuous Update Project Report: Food, Nutrition, Physical Aktivity, and the Prevention of Cancer. Dieser wichtige Bericht ist im Internet frei zugänglich, in englischer Sprache. Verantwortlich für dieses kontinuierlich aktualisierte Projekt ist der World Cancer Research Fund, mehr unter http://wcrf.org/int/research-we-fund/continuous-update-project-cup. Die Eingabe der Stichworte "coffee" oder "tea" führt zu einzelnen Publikationen bzw. Kapiteln des Reports, die sich mit den Auswirkungen auf einzelne Tumorarten befassen.
Die folgende wissenschaftliche Literatur ist überwiegend in englischer Sprache verfasst und meist nicht frei zugänglich. Sie kann in Bibliotheken eingesehen werden oder über entsprechende Fachdienste bestellt werden, mehr dazu im Informationsblatt "Literatursuche" (PDF).
Butt SM, Sultan MT (2011): Coffee and its Consumption: Benefits and Risks. Critical Reviews in Food Science and Nutrition.51 (4)363-373, doi:10.1080/10408390903586412
Cao S, Liu L, Yin X, Wang Y, Liu J, Lu Z (2014): Coffee consumption and risk of prostate cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Carcinogenesis (2014) 35 (2): 256-261. doi: 10.1093/carcin/bgt482
Gressner OA (2009): Less Smad2 is good for you! A scientific update on coffee's liver benefits. Hepatology 50(3), 970-978, doi: 10.1002/hep.23097
Guercio BJ, Sato K, Niedzwiecki D, Ye X, Saltz LB, Mayer RJ, Mowat RB, Whittom R, Hantel A, Benson A, Atienza D, Messino M, Kindler H, Venook A, Hu FB, Ogino S, Wu K, Willet WC, Giovannucci EL, Meyerhardt JA, Fuchs CS (2015): Coffee Intake, Recurrence, and Mortality in Stage III Colon Cancer: Results From CALGB 89803 (Alliance). JCO online 17.8.2015, doi:10.1200/JCO.2015.61.5062
Gunter MJ, Murphy N, Cross AJ, Dossus L, Dartois L, Fagherazzi G, Kaaks R et al. Coffee Drinking and Mortality in 10 European Countries: A Multinational Cohort Study. Ann Intern Med. 2017, 167:236-247. doi: 10.7326/M16-2945
Hashibe M, Galeone C, Buys SS, Gren L, Boffetta P, Zhang ZF, La Vecchia C (2015): Coffee, tea, caffeine intake, and the risk of cancer in the PLCO cohort. Br J Cancer. 2015 Sep 1;113(5):809-16. doi: 10.1038/bjc.2015.276. Epub 2015 Aug 20.
Higdon JV, Frei B (2006): Coffee and Health: A Review of Recent Human Research, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 46:2, 101-123, doi 10.1080/10408390500400009
International Agency for Research on Cancer (IARC) Monograph Working Group. Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. Lancet 2016. Online veröffentlicht am 15. Juni. doi: 10.1016/S1470-2045(16)30239-X.
Islami F et al. (2009): High-temperature beverages and foods and esophageal cancer risk—A systematic review. Int J Cancer 125(3), 491-524, doi:10.1002/ijc.24445
Je Y et al. (2011): A Prospective Cohort Study of Coffee Consumption and Risk of Endometrial Cancer over a 26-Year Follow-Up. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 20(12); 2487–95. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-11-0766
Kennedy OJ, Roderick P, Buchanan R, et al.: Coffee, including caffeinated and decaffeinated coffee, and the risk of hepatocellular carcinoma: a systematic review and dose–response meta-analysis. BMJ Open 2017;7:e013739. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013739
Nkondjock A (2009): Coffee consumption and the risk of cancer: An overview. Cancer Letters 277(2), 121-125, doi:10.1016/j.canlet.2008.08.022
Ohta A, Sitkovsky M (2011): Methylxanthines, Inflammation, and Cancer: Fundamental Mechanisms. In: Fredholm BB (ed.): Methylxanthines, Handbook of Experimental Pharmacology 200, 469-481, doi 10.1007/978-3-642-13443-2_19, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
Park CH, Myung SK et al. (2010): Coffee consumption and risk of prostate cancer: a meta-analysis of epidemiological studies, BJUI 106 (6), 762-769, doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09493.x
Park S, Freedman ND, Haiman CA, Le Marchand L, Wilkens LR, Setiawan VW.
Association of Coffee Consumption With Total and Cause-Specific
Mortality Among Nonwhite Populations. Ann Intern Med. [Epub ahead of
print 11 July 2017] doi: 10.7326/M16-2472
Pelucchi C et al.(2011): Exposure to acrylamide and human cancer--a review and meta- analysis of epidemiologic studies. Ann Oncol. 22 (7):1487-99, doi: 10.1093/annonc/mdq610.
Petrick JL, Freedman ND, Graubard BI et al (2015): Coffee consumption and risk of hepatocellular carcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma by sex - the Liver Cancer Pooling Project. Cancer Epidemiol Biomarkers, online vor Print Juni 2015, doi: 10.1158/1055-9965.EPI-15-0137.
Poole R, Kennedy OJ, Roderick P, Fallowfield JA, Hayes PC, Parkes J: Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. BMJ 2017;359:j5024, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j5024
Pounis G, Tabolacci C, Costanzo S, Cordella M, Bonaccio M, Rago L, D'Arcangelo D, Filippo Di Castelnuovo A, de Gaetano G, Donati MB, Iacoviello L, Facchiano F; Moli-sani study investigators. Reduction by coffee consumption of prostate cancer risk: Evidence from the Moli-sani cohort and cellular models. Int J Cancer. 2017 Apr 24. doi: 10.1002/ijc.30720.
Schmidt S, Rennert H, Rennert G, Gruber S. Coffee Consumption and the Risk of Colorectal Cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2016. 25:634-639; doi: 10.1158/1055-9965.EPI-15-0924.
Silberstein JL, Parsons JK (2010): Evidence-based Principles of Bladder Cancer and Diet. UROLOGY 75: 340–346, doi:10.1016/j.urology.2009.07.1260.
Turati F, Bosetti C, Polesel J et al. (2015): Coffee, Tea, Cola and Bladder Cancer Risk: Dose- and Time-Relationships. Urology, online 9/2015, doi:10.1016/j.urology.2015.09.017.
Vinson J, Bonita JS et al. (2007: Coffee and cardiovascular disease: In vitro, cellular, animal, and human studies. Pharmacological Research 55 (3), 187-198. doi:10.1016/j.phrs.2007.01.006.
Zou J et al. (2011): Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer 11(96), doi:10.1186/1471-2407-11-96.
Krebsinformationsdienst , Deutsches Krebsforschungszentrum | Im Neuenheimer Feld 280 | 69120 Heidelberg
Instant-Kaffee: Kulinarischer Abgrund oder unterschätzte Alternative?
Instant-Kaffee ist für den Kaffee-Gourmet der Inbegriff des Grauens. Doch warum eigentlich? Ist löslicher Kaffee wirklich völlig unvertretbar? Und wer hat ihn überhaupt erfunden, wie wird er hergestellt und wo tatsächlich gern getrunken? Unser kleiner Instant-Führer gibt (fast) neutrale Antworten.
Eine kurze Geschichte des löslichen Kaffees
Nicht umsonst ist das bekannteste Synonym für Instant-Kaffee der Markenname ‘Nescafe’. Genauso hieß nämlich der erste sofort lösliche und kommerziell erfolgreiche Kaffee, den der Nestle-Konzern in den 1938 in Brasilien einführte. Bis heute hat der Nescafe sich weltweit nicht vom Spitzenplatz der fixen Bohnenalternative vertreiben lassen. Laut Nestle werden auf dem Globus sekündlich 3.600 Tassen Nescafe getrunken.
Dabei hat der Schweitzer Mega-Konzern den löslichen Kaffee gar nicht erfunden – patentiert wurde er bereits 1890 vom Neuseeländer David Strang. Ob dabei die Bequemlichkeit der Zubereitung an erster Stelle stand, ist nicht einmal klar. Unter Umständen war die ursprüngliche Idee auch, Kaffee lagerungsfähiger zu machen.
Soziologen betrachten die Erfindung als ein schlüssiges Puzzleteil in einer Nachkriegsentwicklung hin zu schnellen kulinarischen Lösungen wie Fast Food und Drive-In-Diners; Tiefkühlessen und nicht viel später die dazugehörige Mikrowelle; dem heute sogenannten “Convenient Food”, damals im Ursprungsland USA “TV Dinner” genannt; und der neuen Tendenz, Essen in kleinen Portionen in Plastik zu verpacken.
Zu Anfang gab sich die Kaffee-Industrie noch Mühe, die lösliche Variante als so gut wie Omas traditionell von Hand aufgegossene Tasse zu verkaufen. Doch bald ändert sich der Tenor der Verkaufsstrategien – und der Verweis auf Bequemlichkeit und Einfachheit dominierte.

Mahlen, Aufgießen, Trocknen: Die Reise der Bohne zum Granulat
Auch jeder lösliche Kaffee fängt mal als Bohne an, die geröstet, gemahlen und mit heißem Wasser übergossen wird, bis starker Kaffeeextrakt daraus geworden ist. Weitere Zusatzstoffe sind übrigens nicht gestattet!
Für die Herstellung der Konzernprodukte werden eigentlich nie Kaffees einzelner Hersteller oder Anbauflächen genutzt; damit würden Großproduzenten zu abhängig vom Ertrag und der Preisgestaltung einzelner Anbieter werden. Stattdessen kommen Rohkaffeemischungen, die sogenannten “Blends”, zum Einsatz.
Die Röstung für die Herstellung von löslichem Kaffee fällt verhältnismäßig dunkel aus; der verbleibende Wasseranteil in den Bohnen sollte noch relativ hoch sein. Beim anschließenden Mahlen kommt es auf eine grobe und gleichmäßige Körnung an. Diese verhindert ein Verstopfen der für die anschließende Extraktion genutzten Apparate.
Dieser Extraktions-Vorgang allein ist schon hochtechnisiert. Noch komplexer wird der nächste Schritt, der Trocknungsvorgang. Das ist die Ironie des Instant-Kaffees: Um ihn zu einem umkomplizierten, schnellen Genuss zu machen, ist seine Herstellung ausgesprochen energie- und arbeitsaufwendig.
Zunächst müssen die löslichen Stoffe mit kalkarmem Trinkwasser (EU-Vorschrift) aus den gemahlenen Bohnen extrahiert werden.
Effizient, aber Barrista-Romantik sieht doch anders aus: Extraktions-Technologie
Dafür werden hinter einander geschaltete Perkolatoren (siehe Bild) mit gemahlenem Kaffee befüllt und nach Durchlauf vom Kaffeesatz (denn nichts anderes ist extrahiertes Mahlgut) wieder befreit. Dabei befinden sich meist mindestens sechs dieser Extraktionssäulen hintereinandergeschaltet. Frischwasser wird bei 170 bis 190 Grad Celcius und mit bis zu 20 Atmosphären Druck durch das Mahlgut in den Perkolatoren geleitet. Der entstandene, noch heiße Extrakt wird anschließend sofort gekühlt und entweder per Filter oder Zentrifuge gereinigt. Das nicht mehr benötigte Mahlgut wird getrocknet und bestenfalls zur Energiegewinnung verwendet. Auch wenn die Art der Trocknung ebenfalls eine Rolle spielt: Während der Extraktion entscheidet sich, wie aromatisch der Instant-Kaffee hinterher noch ist.
Danach wird dem entstandenen Kaffee-Dünnsaft nochmals Flüssigkeit entzogen, durch Verdampfen im Vakuum oder Gefrierkonzentrierung – einem Verfahren, bei dem Wasser bei unter 0°C in einem komplett geschlossenen System kristallisiert und die Eiskristalle durch Zentrifugieren vom Extrakt abgetrennt werden. Durch diese Vorkonzentration wird das Kaffeearoma besonders schonend erhalten – und die anschließende Trocknung ist weniger kostspielig.


Sprüh- oder Gefriertrocknung – eine Frage der Kosten
Der Trocknungsvorgang kann als Sprüh- oder Gefriertrocknung erfolgen.
Bei der Sprühtrocknung wird der extrahierte Kaffeedicksaft mit Druck durch Düsen in einem Trockenturm gesprüht und zu Tröpfchen zerstäubt. Diese werden dann mit heißer Luft verwirbelt und im Heißluftstrom getrocknet. Die noch enthaltene Flüssigkeit verdunstet; übrig bleiben winzige Hohlkügelchen aus reinem Kaffee. Diese werden häufig mit Wasserdampf nochmals kurz befeuchtet (agglomeriert), so dass mehrere Kügelchen zusammen haften; das macht den Kaffee später besonders gut löslich. Die Partikel kühlen dann während des Falls ab und werden im unteren Teil des Turmes aufgefangen.
Kaffee-Hohlkügelchen unter dem Mikroskop
Schonender als die Sprühtrocknung ist die Gefriertrocknung. Dabei wird der flüssige Kaffeeextrakt bei – 40 bis – 50 Grad Celsius tiefgefroren. Das entstandene Kaffeeeis wird in einer Kälteanlage unter Vakuum sehr behutsam wieder erwärmt, so dass das austretende Wasser sofort verdampft und nur trockene Kaffeepartikel zurückbleiben. Dieses Vorgehen ist aufwendiger und teurer, erhält allerdings mehr des ursprünglichen Aromas. Kaffeeliebhaber sollten deshalb immer auf den Hinweis „gefriergetrocknet“ oder „freeze dried“ auf ihrem Instant-Kaffee achten.
Auch wenn die Gefriertrocknung behutsamere Trocknungsbedingungen bietet, gehen beide Methoden doch zu Lasten von Aroma und Koffeingehalt im Vergleich zu den unbehandelten, gerösteten Bohnen.

Ein cleveres Versteck für minderwertigen Kaffee?
Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass für die Produktion von Instant-Kaffee hauptsächlich preiswertere Robusta-Bohnen benutzt werden, um die Nachfrage zuverlässig decken zu können und den Profit zu erhöhen. Allerdings ist die Preisdifferenz zwischen den Bohnenarten nicht mehr so groß, wie sie mal war – und inzwischen fügen immer mehr vor allem kleinere Hersteller, ihren Produkten auch Arabica-Bohnen hinzu. Ein 100% Arabica Instant-Kaffee ist immer noch selten – aber es gibt ihn, vor allem in Bio- und sogar Demeter-Qualität. Er ist definitiv empfehlenswert, auch trotz des leicht höheren Preises.
Vorteile und Nachteile von löslichem Kaffee
Klar, der Instant Kaffee ist von Natur aus das “schnellere” Produkt – daher auch sein Erfolg. Es braucht keine zusätzliches Equipment, außer einem Löffel (und nicht mal diesen unbedingt), einer Tasse und kochendem Wasser. Doch was sind die gesundheitlichen Auswirkungen der fixen Alternative – und gibt es überhaupt welche?


Erhöhter Acrylamid-Anteil im Instant-Kaffee
Durch beide Verarbeitungsschritte zur Herstellung von Instant-Kaffee bildet sich zusätzlich Acrylamid, das ja auch schon durch den Röstvorgang generiert wurde. Deshalb enthält löslicher Kaffee pro Gewichtseinheit mehr Acrylamid als die geröstete, gemahlene Bohne. Grundsätzlich ist Acrylamid ein Nervengift und eventuell krebserregend (bei Tieren ist es dies sicher). Während in Röstkaffee nur etwa 180 microg/kg Acrylamid vorkommen, sind es in löslichem Kaffee ziemlich genau das Doppelte, nämlich 360 microg/kg. Allerdings: Für eine Tasse Kaffee nutzen fast alle Verbraucher weniger Instant-Pulver als für dieselbe Tasse Bohnenkaffee aufgegossen würde. Deshalb ergab sich bei allen Praxistests, dass der Acrylamid-Gehalt in Instant-Kaffee und Filterkaffee pro Tasse im Endeffekt identisch ist.
Weniger Antioxidantien und Koffein
Das Vorkommen von Antioxidantien wie etwa das krampflösende, blutzucker-senkende Chinin im Kaffee ist einer der Hauptgründe, seinen mäßigen Konsum durchaus auch aus medizinischer Sicht zu empfehlen. Durch den Extraktions- und Trocknungs-Prozess des Instant Kaffee gehen allerdings viele dieser wunderbaren anti-oxidanten Eigenschaften verloren. Auch das natürlich enthaltene Magnesium nimmt durch die Prozessierung des Kaffees erheblich ab – der Koffeingehalt ist in löslichem Kaffee sowieso niedriger.
Ein langer Weg vom Busch bis zum Trocken-Granulat im Glas
Instant-Kaffee ist in jedem Fall ein paar Welten entfernt von einem frisch aufgebrühten, guten Demeter-Kaffee. Was wegfällt, ist das liebevoll zelebrierte, wenn auch (oder gerade: zum Glück) zeitintensive Ritual des selber Mahlens und Aufbrühens, unabhängig von der Methode nach Wahl. Den Kick, denn unser Gehirn durch die olfaktorische Aufnahme von frisch gemahlenem Kaffeegeruch erlebt, setzt bei Instant-Kaffee nicht ein – egal, wie hochwertig er ist. Schon daran sehen wir den Zusammenhang zwischen instinktiver Präferenz möglichst unverarbeiteter Produkte im Gegensatz zu “Convenience-Food”, ungeachtet aller energetischer (und deshalb oft als esoterisch empfundener) Erwägungen.
Instant-Kaffee weltweit beliebter als gefilteter
Dennoch, die Erfolgsgeschichte des löslichen Kaffees ist weltweit gesehen ungebrochen. Wenn er sich auch in Deutschland oder den Vereinigten Staaten wahrscheinlich aufgrund des sich immer weiter ausbreitenden Coffee-to-go Phänomens und der mittlerweile allgegenwärtigen Kaffeekapseln und Pads nicht an die Spitze des insgesamt konsumierten Heißgetränkes setzt, ist dies auf vielen Teilen des Globus entscheidend anders. Seit der Jahrtausendwende hat sich der Verkauf von löslichem Kaffee weltweit verdreifacht, wie das international tätige Marktforschungsunternehmen Euromonitor ermittelt hat. Auf der ganzen Welt wurde in den letzten Jahren jährlich für 31 Milliarden Dollar Instant-Kaffee konsumiert – mit steigender Tendenz. Bis 2018, so Euromonitor, wird der jährliche Verbrauch auf einen Wert von 35 Milliarden Dollar geschätzt. Damit würde die schnelle Art des Koffeingenusses 34 Prozent des gesamten, globalen Kaffeekonsums ausmachen.
Ethnologen sehen den Trend zum Instant-Kaffee allerdings direkt verknüpft mit der Frage, ob ein Land eine bereits vorhandene Kaffeekultur besitzt. Je mehr das Kaffeetrinken in der kulinarischen Tradition eines Landes verankert ist, desto weniger löslicher Kaffee wird dort abgesetzt. Es scheint, als ob das Granulat in vielen Fällen als so etwas wie das Initiierung in den Kaffeegenuss ist – eigentlich paradox, repräsentiert diese Form der Hochverarbeitung doch keinesfalls das volle Aroma-Erlebnis, das guter Röstkaffee bietet.
Dennoch erklärt sich so, warum gerade Indien und China die riesigen Märkte sind, auf denen der Verbrauch von löslichem Kaffee in geradezu schwindelerregendem Maße wächst… wobei hinzu gesagt werden muss, dass gerade Süd-Indien den unvergleichlich wohlschmeckenden Kaapi Kaffee kultiviert, faszinierende Veredelungsverfahren wie den Monsum Kaffee kennt und spezielle Formen der Zubereitung entwickelt hat…doch dazu in einem anderen Beitrag mehr. In Indien geht die Neigung zum Instant-Kaffee wohl eher einher mit der Adoption westlicher „Fortschrittsmerkmale“.
Weltweit führend im Konsum von löslichem Kaffee aber ist Australien. Mehr als 75% des dort und in Neuseeland verkauften Kaffees gehört der schnellen Sorte an – das ist der global größte gemessene Marktanteil. In Osteuropa beträgt der Anteil immer noch etwa 50%, in Westeuropa dann nur noch 25% – was vielleicht auch an Ländern wie Italien oder Österreich liegt, in denen die Kaffeetradition einfach ins Alltagsleben einfließt.


Nur die Amerikaner verabscheuen Instant Kaffee
In den USA herrscht eine richtig gehende Aversion gegen löslichen Kaffee, wie Umfragen immer wieder zeigen. Das ist eigentlich schade – denn auf der anderen Seite herrscht in keinem anderen Land eine so rege Nachfrage nach schnell verfügbarem, tassenweise portionierbarem Kaffee. Das Ergebnis: Kaffeekapselmaschinen boomen in den USA – und produzieren genug Abfallkapseln, um damit unseren Planeten zehnmal zu umrunden. Zumindest diese Umweltbelastung könnte vom allerdings zugegeben etwas weniger aromatischen Instant Kaffee vermieden werden.
Selbst die in den USA fast wie ein Heiligtum verehrte Marke Starbucks war nicht in der Lage, die Anti-Instant-Front der Amerikaner zu brechen. 2009 führte das Unternehmen seinen eigenen löslichen Kaffee “Via” ein, der seitdem in 26 Ländern der Welt sehr erfolgreich verkauft wird – und in den USA gnadenlos floppte. Auch Nestlé beißt sich überm Teich die Zähne aus. Der Nescafé-Absatz stagniert dort seit Jahren.
Instant-Kaffee muss kein billiges Produkt sein – ist es aber oft
Um sicher zu gehen, dass auch Ihr löslicher Kaffee ethischen Standards entspricht, achten Sie am besten auf drei Merkmale: Er sollte biologisch angebaut sein, unter fairen Herstellungsmethoden produziert werden (hierfür steht “FairTrade” oder andere faire Handelssiegel) und möglichst boden- und vogelfreundlich angepflanzt werden.
Vor allem letzteres Kriterium ist nicht immer eindeutig ersichtlich. Bei einem vogelfreundlichen, überschattetem Anbau wird mit Hilfe von Mischpflanzungen das Land nicht ausgelaugt, die Artenvielfalt nicht durch Monokulturen bedroht, der Boden bekommt genug Schutz vor Austrockung und zwischen den Kaffeebäumen wird eine Auswahl an vogelfreundlichen Pflanzen kultiviert. Jeder entsprechend engagierte Kaffeeanbauer wird mindestens auf seiner Homepage diese Form des Kaffeeanbaus erläuern.
Im Schatten gewachsener, pestizid- und düngemittelfreier Kaffee: Vogelparadies und Qualitätsgarant
Sind diese Kriterien erfüllt, können Sie sicher sein, dass in der Herstellung des Instant-Kaffees keine Chemikalien zur längeren Haltbarkeit und keine Pestizide verwendet wurden und dass die Bauern, Pflücker und Weiterverarbeiter unter gerechten Bedingungen zu einem fairen Lohn arbeiten.
Tipps rund um den Instantkaffee
Noch ein Tipp bei der Zubereitung: Geben Sie zum trockenen Granulat im Becher (und, im Fall des Falles, dem Zucker oder den Gewürzen, die ebenfalls trocken untergemischt werden) zunächst ein klein wenig kaltes Wasser dazu. Verrühren Sie alles zu einer Paste und gießen Sie es erst dann mit kochendem Wasser auf. Der Geschmacksunterschied zum direkt aufgegossenen Instant-Kaffee wird Sie überraschen. Die wissenschaftliche Erklärung für diesen kulinarischen Quantensprung: Der Heiß-Wasser-Schock erhärtet die im Granulat enthaltene Stärke, was zu einem pudrigen, “trockenen”, eher flachen Geschmack führt. Im kalten Wasser verflüssigt sich die Stärke langsamer, was ein weicheres, runderes Aroma generiert.
Übrigens: In jedem Fall zum Genusserlebnis wird löslicher Kaffee, wenn er mit einem Hauch Kakao zu Mocca oder mit Gewürzen wie Zimt, Kardamon oder Vanilleextrakt zu einer orientalischen Spezialität “aufgehübscht” wird. Für Backrezepte und eine schnelles Tiramisu eignet sich Instant-Kaffee ebenfalls exzellent.
Das gleiche gilt für einen schnellen Eiscafé. Verrühren Sie hierfür entweder einen Teelöffel Kaffeepulver mit zwei Teelöffeln heißem Wasser oder nehmen Sie für einen stärkeren Eiskaffee, zwei Teelöffel Kaffee und vier Teelöffel heißes Wasser. Das Resultat sollte ein dicker, sämiger Kaffeeextrakt sein. Geben Sie 250 ml kalten Wassers oder Milch hinzu – natürlich können Sie Beides auch nach Geschmack mischen – und rühren Sie gut um. Zum Schluss gießen Sie den nun kalten Kaffee über ein paar Eiswürfel in einem hohen Glas mit ausreichend Fassungsvermögen.
Kaffee: 31 Marken im Test
Kaffeevariationen: Alles aus der Bohne
Röstkaffee: Die Bohnen werden bei etwa 260 Grad geröstet, ganz oder gemahlen verkauft. Röstkaffee eignet sich für Kaffeemaschinen, den Hand- oder Kolbenkannenaufguss.
Melange: In Wien nennt man so eine Kaffeespezialität – halb Kaffee, halb Milch. Im Test heißen aber zwei Kaffees Melange, bei denen die Bohnen mit Zuckerarten kandiert wurden. Die Süßungsmittel machen bis zu 10 Prozent des Kaffees aus.
Espresso: Die Bohnen werden länger und dunkler geröstet als für herkömmlichen Röstkaffee und verlieren so an Säure. Das sehr feine Pulver wird unter Hochdruck in knapp 30 Sekunden zubereitet. Der fertige Espresso ist schwarz und hat weniger Koffein als Röstkaffee. Typisch: die Schaumschicht (Crema).
Entkoffeinierter Kaffee: Er ist etwas für Menschen, die kein Koffein möchten. Dem Rohkaffee wird das Koffein mit Dampf oder Lösemitteln entzogen (Restkoffein: 0,1 Gramm je 100 Gramm Kaffeetrockenmasse).
Löslicher Kaffee: Er entsteht aus einem Konzentrat, für das gemahlene Bohnen mit heißem Wasser übergossen werden. Durch Gefriertrocknung gewinnt man das Granulat.
Milder Kaffee: Durch die Auswahl säurearmer Kaffeesorten schmecken sie milder. Die Reizstoffe sind anders als beim Schonkaffee nicht reduziert.
Dieser Artikel ist hilfreich. 1405 Nutzer finden das hilfreich.
Instantkaffees: SГјГџes Pulver mit Beigeschmack
Dipl. oec. troph. Claudia Gaster
Ein Alltag ohne den kleinen Kaffee zwischendurch ist für viele undenkbar. Neben dem Kult um die vollautomatische Espressomaschine behauptet sich der schnelle Lösliche zum Umrühren. Auch in Bioqualität wird das Instantangebot immer größer. Doch wie schlägt man Schaum ohne Zusatzstoffe?

Aus konventionellen SupermГ¤rkten kennen wir sie schon lГ¤nger – Regale voller lГ¶slicher Kaffeezubereitungen von einfachem Kaffee Гјber Cappuccino bis zu Latte Macchiato und Kaffee mit Kirscharoma. Die Biobranche zieht nach. Neben Kaffee mit und ohne Coffein, Cappuccino mit und ohne Kakao fГ¤llt vor allem das groГџe Sortiment an lГ¶slichen Getreidekaffees auf.
Langes Verfahren fГјr schnelle Tassen
LГ¶sliches Kaffeepulver wird von konventionellen wie von Bioanbietern entweder durch SprГјhtrocknung oder durch Gefriertrocknung hergestellt. Ausgangsprodukt ist in beiden FГ¤llen ein sehr starker Kaffeeaufguss. Bei der SprГјhtrocknung wird dieser Extrakt in feinsten TrГ¶pfchen von einem SprГјhturm in einen HeiГџluftstrom gesprГјht. Auf der mehrere Meter langen Fallstrecke wird den Tropfen die FlГјssigkeit entzogen. Bei der Gefriertrocknung oder Lyophilisation wird der Kaffeeextrakt im Vakuum eingefroren. Der Kaffee wird anschlieГџend schlagartig in Dampf ГјberfГјhrt, wodurch der Wasseranteil entweicht. Die Gefriertrocknung ist zwar energetisch aufwГ¤ndiger, schont das Aroma aber besser, weil das Produkt nicht so stark erwГ¤rmt wird. LГ¶slicher Biokaffee muss bei der Zubereitung in der Regel stГ¤rker gerГјhrt werden als der konventionelle. Denn die meisten Hersteller lassen einen weiteren Verarbeitungsschritt, die Agglomeration, weg. HierfГјr werden die InstantkГ¶rner mit einem feinen Wasserstrom so benetzt, dass sie auГџen feucht sind. Einzelne KГ¶rnchen heften sich dann aneinander und bilden ein Granulat. Wenn dann bei der Zubereitung das Wasser in die feinen Spalten im Granulat eindringt, bilden sich seltener KlГјmpchen.Bio-Instantkaffees verzichten zudem auf Trennmittel wie Silikate – ein weiterer Grund warum sich Biopulver schlechter lГ¶st. Die staubfein gemahlenen KieselsГ¤ureverbindungen umhГјllen die InstantkГ¶rner von konventionellen Produkten und verhindern, dass sie zusammenkleben.
Schaumhäubchen aus der Dose
Die Krönung jedes Capuccinos ist die schaumige Milchhaube. Während bei frisch gebrühtem Cappuccino die heiße Milch durch Schlagen oder Wasserdampf aufgeschäumt wird, gelingt eine Schaumhaube bei Instantkaffees nur durch Zugabe von Magermilchpulver. Der Schaum fällt jedoch schnell wieder in sich zusammen. Um ihn länger zu erhalten, sind konventionellen Produkten gehärtete Pflanzenöle und Stabilisatoren wie Kaliumorthophosphat oder Stärkenatriumoctenylsuccinat zugesetzt. Doch selbst mit Stabilisatoren bilden sich beim Abkühlen unansehnliche Klümpchen. Bioanbieter lassen Stabilisatoren und das Fett ganz weg oder setzen ungehärtetes Pflanzenfett wie Palmfett ein. Insgesamt erfüllen lösliche Cappuccinos nur wenn sie frisch aufgegossen werden, die in sie gesetzten Erwartungen an Optik und Geschmack. An das Mundgefühl des frisch zubereiteten Getränkes kommen sie nicht heran.Neben Magermilchpulver, Kaffeeextrakt und Stabilisatoren besteht das fertige Pulver zum großen Teil aus Zucker. Biohersteller setzen überwiegend den etwas weniger verarbeiteten Rohrohrzucker ein. Aber auch süßender Maissirup, weißer Zucker und Lactose sind in den Biomischungen zu finden. Während beim löslichen Biopulver genau auf der Verpackung angegeben ist, was alles darin steckt, lassen konventionelle Hersteller den Verbraucher im Unklaren. Die Zusatzstoffe sowie das Magermilchpulver verbergen sich hier hinter dem Begriff Kaffeeweißer. Eine volle Deklaration ist nicht vorgeschrieben.
Körner statt Bohnen
Für lösliche Biokaffees auf Getreidebasis verwenden die Hersteller überwiegend Weizen, Gerste, Roggen oder Dinkel. Der so genannte Malzkaffee verdankt seinen Namen dem Prozess des Mälzens, bei dem eingeweichtes Getreide zum Keimen gebracht wird. Im Getreidekorn bauen Enzyme daraufhin Stärke zu Malzzucker ab. Beim Rösten wird die Keimung gestoppt und Aromastoffe gebildet. Geröstete Eicheln, Feigen und Zichorienwurzeln runden mit ihren Bitter- und Gerbstoffen das Aroma ab. Aus dem gemahlenen Zutatenmix und heißem Wasser bereiten die Hersteller wie beim Kaffee einen starken Extrakt, der sprühgetrocknet wird. Getreidekaffee ist für alle eine Alternative, die Probleme mit dem Magen haben oder Coffein sparen wollen. Denn die gemälzten Körner sind coffeinfrei und enthalten deutlich weniger Gerbsäuren als Bohnenkaffee.Beim Kaffeerösten wie bei der Herstellung von Getreidekaffee entstehen neben den erwünschten Aromastoffen auch unerwünschte Substanzen. Kritisch zu beobachten ist der Gehalt an Acrylamid, das im Tierversuch krebserregend ist. Ob auch für den Menschen eine Krebsgefahr besteht, ist noch unsicher. Während eine Tasse Kaffee durchschnittlich zwei bis vier Mikrogramm Acrylamid enthält, können es bei Getreidekaffee bis zu 16,4 Mikrogramm sein. Mehr als zwei bis drei Tassen pro Tag sind demnach nicht empfehlenswert.
Nichts fГјr Umweltbewusste
Eine wachsende Zahl an KГ¤ufern ist offensichtlich bereit, fГјr die bequeme Zubereitung pro Tasse mehr zu zahlen. Dabei vertrГ¤gt sich das hoch verarbeitete Pulver gar nicht mit dem Anspruch an eine naturbelassene Nahrung. Denn die Bequemlichkeit erfordert einen hohen Verarbeitungsgrad und Energieeinsatz. Mit den landwirtschaftlichen Ausgangsprodukten – Kaffeebohnen, Milch und Zuckerrohr – haben die lГ¶slichen Pulver nur noch wenig gemein.
Fertige Instantmischungen fГјr Cappuccino und andere Kaffeesorten lassen zudem wenig Spielraum fГјr eigene Vorlieben oder RГјcksicht auf die Gesundheit. Sowohl die Kaffeekonzentration als auch die Zuckermenge ist vorgegeben. FГјr Menschen mit Milchallergie oder Lactoseintoleranz sind magermilchhaltige KaffeegetrГ¤nke sowieso nichts. Wer Wert auf Geschmack legt oder bestimmte Zutaten nicht vertrГ¤gt, sollte vielleicht doch in eine Espressomaschine investieren, sich seine (Reis- oder Soja)Milch aufschГ¤umen, alternative SГјГџungsmittel nach eigenem Gusto verwenden und sich damit abfinden, dass Genuss eben Zeit kostet – was die Pause verlГ¤ngert und die Umwelt schont.
Quelle: Gaster, C.: UGB-FORUM 1/07 S. 23-24
в–¶пёЋ Newsletter
• Neues aus der Wissenschaft
• Rezept des Monats
• Stellenangebote im Bereich ErnГ¤hrung/
• UGB-Veranstaltungen und neue Medien
в–¶пёЋ Probeabo
 Ernährungsinformationen gibt es viele. Doch wirklich unabhängige Berichterstattung ist rar. Das UGBforum ist unbeeinflusst von Ernährungs- und Pharmaindustrie und komplett werbefrei. Das garantiert nicht nur 100 % Information, sondern auch eine unabhängige und kritische Berichterstattung. Überzeugen Sie sich selbst!
Ernährungsinformationen gibt es viele. Doch wirklich unabhängige Berichterstattung ist rar. Das UGBforum ist unbeeinflusst von Ernährungs- und Pharmaindustrie und komplett werbefrei. Das garantiert nicht nur 100 % Information, sondern auch eine unabhängige und kritische Berichterstattung. Überzeugen Sie sich selbst!
Verwandte Stichwörter .
Alle Artikel zum Thema Instantkaffee .
Weitersagen
Termine
Kooperationspartner
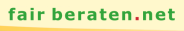


(Mo.-Fr. 9.00 - 15.00 Uhr, Do. 9.00 - 17.00 Uhr)
Datenschutz
Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.
© 2016 Verband fГјr UnabhГ¤ngige Gesundheitsberatung
Kapsel Kaffee
Viele Leute kaufen die sehr teuren Kappseln ,haben Sie schon mal nachgerechnet was das Kg kostet ? Schnell ist man hier bei über 60€ pro Kg!
Ohne wirklich zu wissen was wirklich in so einer Kapsel steckt erfreuen Sich immer mehr Konsumnenten an den Kapslen und den Pads.
Die Beqwemlichkeit siegt und in der Werbung sieht das ja auch immer so toll aus.
Denken Sie wirklich es ist nur feinstes Kaffee Pulver in den Kapseln/Pads enthalten?
In Test die uns unser Prof. Vorgestellt hat wurden in einer Kapsel/Pad folgendes nachgewiesen:
bei der Zubereitung passiert folgendes, heißes Wasser wird mit hohen Druck in die Kapseln gedrückt. Dabei entsteht in der Kapsel Furan was durch die geschlossene Kapsel nicht entweichen kann.
(Furan ist Krebserregend)
Au Social Media teilen
Cookie-Regelung
Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.
Kaffee
- Bestenliste
- Komplette Tests
- Ratgeber

Typ: Kaffeekapseln; Herkunft: Südamerika
Sensorische Beurteilung (60%): „sehr gut“ (1,5); Probleme bei der Zubereitung (0%): keine; Schadstoffe (20%): „befriedigend“ (3,1); Verpackung (10%): „befriedigend“ (2,6); Deklaration (10%): . “  Weitere Informationen in: test (Stiftung Warentest), Heft 11/2015 Nespresso legt die Latte hoch Kaffeekapseln: Nestlé macht mit seinem Nespresso den besten Kaffee im Test. Doch die Konkurrenz zieht nach. Auch andere Anbieter verkaufen aromatischen Kaffee in Kapseln, darunter Lavazza und Senseo. Was wurde getestet? Die Stiftung Warentest nahm 14 Kaffeekapseln zur Zubereitung von Kaffee, Caffè Crema oder Lungo in Augenschein. Darunter waren 7 Produkte für Maschinen mit Nespresso-System, eine Kapsel für Dolce-Gusto-Maschinen sowie 6 Kapseln, die jeweils nur zu einem speziellen Maschinensystem passen. Die Bewertungen lauteten 7 x „gut“ und 7 x „befriedigend“. Als Bewertungskriterien zog man die sensorische Beurteilung, Probleme bei der Zubereitung, Schadstoffe (Acrylamid, Ochratoxin A, Furan pro zubereiteter Tasse, Metalle und Mineralöle, Aluminium), Verpackung und Deklaration heran. Gab es häufig Probleme bei der Zubereitung, wertete man das Qualitätsurteil um eine Note ab. Bei einem „ausreichenden“ Schadstoffurteil konnte das Testurteil maximal eine halbe Note besser sein. Der Einkauf der Prüfmuster erfolgte im Zeitraum von April bis Mai 2015. Ein Adressverzeichnis auf einer Seite liegt dem PDF bei. … zum Test
Weitere Informationen in: test (Stiftung Warentest), Heft 11/2015 Nespresso legt die Latte hoch Kaffeekapseln: Nestlé macht mit seinem Nespresso den besten Kaffee im Test. Doch die Konkurrenz zieht nach. Auch andere Anbieter verkaufen aromatischen Kaffee in Kapseln, darunter Lavazza und Senseo. Was wurde getestet? Die Stiftung Warentest nahm 14 Kaffeekapseln zur Zubereitung von Kaffee, Caffè Crema oder Lungo in Augenschein. Darunter waren 7 Produkte für Maschinen mit Nespresso-System, eine Kapsel für Dolce-Gusto-Maschinen sowie 6 Kapseln, die jeweils nur zu einem speziellen Maschinensystem passen. Die Bewertungen lauteten 7 x „gut“ und 7 x „befriedigend“. Als Bewertungskriterien zog man die sensorische Beurteilung, Probleme bei der Zubereitung, Schadstoffe (Acrylamid, Ochratoxin A, Furan pro zubereiteter Tasse, Metalle und Mineralöle, Aluminium), Verpackung und Deklaration heran. Gab es häufig Probleme bei der Zubereitung, wertete man das Qualitätsurteil um eine Note ab. Bei einem „ausreichenden“ Schadstoffurteil konnte das Testurteil maximal eine halbe Note besser sein. Der Einkauf der Prüfmuster erfolgte im Zeitraum von April bis Mai 2015. Ein Adressverzeichnis auf einer Seite liegt dem PDF bei. … zum Test
2 Testberichte | 16 Meinungen

Typ: Kaffeekapseln; Mild
Sensorische Beurteilung (60%): „gut“ (2,0); Probleme bei der Zubereitung (0%): keine; Schadstoffe (20%): „befriedigend“ (3,2); Verpackung (10%): „befriedigend“ (2,7); Deklaration (10%): …
2 Testberichte | 99 Meinungen
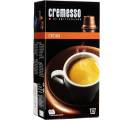
Typ: Kaffeekapseln; Mild; Herkunft: Asien, Südamerika
Sensorische Beurteilung (60%): „gut“ (2,0); Probleme bei der Zubereitung (0%): keine; Schadstoffe (20%): „befriedigend“ (3,3); Verpackung (10%): „befriedigend“ (3,0); Deklaration (10%): …
2 Testberichte | 4 Meinungen
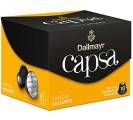
Sensorische Beurteilung (60%): „gut“ (2,0); Probleme bei der Zubereitung (0%): keine; Schadstoffe (20%): „befriedigend“ (3,0); Verpackung (10%): „befriedigend“ (2,6); Deklaration (10%): …
2 Testberichte | 78 Meinungen

Typ: Kaffeebohnen; Würzig
Der auffällig verpackte Gorilla Espresso der deutschen Kaffeerösterei Joerges überzeugt mit einer milden und aufrichtigen Note, die einen an dunkle Schokolade denken lässt. Mit seinem doch eher kräftigen Geschmack ist der Espresso ein sehr guter Dessert-Begleiter oder kann selbst als Nachtisch fungieren.
1 Testbericht | 54 Meinungen

„Diese Sorte ist der Bezeichnung nach eher für klassischen Kaffee gedacht. Da sie weniger Körper bietet und nicht übermäßig aromatisch schmeckte, empfehlen wir diese Röstung eher als Grundlage für . “
1 Testbericht | 250 Meinungen

Lavazzas Bohnenkaffee Espresso Perfetto wird viele Geschmäcker zufriedenstellen können. Die harmonische Sorte überzeugt sowohl bei der normalen Kaffeezubereitung als auch beim Espresso. Die Bitterstoffe halten sich angenehm zurück, das Getränk selbst hat einen vollen Geschmack mit einer kräftigen Note. Zurückhaltend und dennoch sehr angenehm ist der Lavazza eine Empfehlung wert.
1 Testbericht | 116 Meinungen

Lavazzas Kaffeekapseln der Sorte A Modo Mio Espresso sind laut Hersteller für das Espresso-System gleichen Namens geeignet. Das Labor fand im Kaffeeaufguss Nickel, was sich nicht negativ auf das Teilergebnis für die Inhaltstoffe auswirkte. Bei der Handhabung gab es ebenfalls keine Beanstandungen. Einzig der Aspekt von Kapselproduktion und Transparenz wurde aufgrund der fehlenden Nachweise für fair gehandelten Kaffee als „ungenügend“ bewertet.
1 Testbericht | 43 Meinungen

Typ: Kaffeekapseln; Herkunft: Afrika
Sensorische Beurteilung (60%): „gut“ (2,5); Probleme bei der Zubereitung (0%): keine; Schadstoffe (20%): „befriedigend“ (3,0); Verpackung (10%): „ausreichend“ (3,6); Deklaration (10%): …
2 Testberichte | 119 Meinungen

Liebhabern italienischer Kaffeespezialitäten wird der Geschmack des Caffè Crema e Aroma von Lavazza definitiv gefallen. Das Aroma ist kräftig und setzt ordentlich Bitterstoffe frei. Damit kann er sehr gut als Espresso oder als Grundlage für andere Spezialitäten dienen. Auch für den Vollautomat geeignet. Es bietet sich jedoch an, den intensiven Geschmack mit Zucker etwas abzumildern.
1 Testbericht | 60 Meinungen

Typ: Kaffeepads; Mild

Typ: Kaffeebohnen; Würzig
Der Name des Dallmayr-Produkts macht keine falschen Versprechungen. Der Crema d'Oro Intensa hat einen kräftigen und würzigen Geschmack mit viel Aroma. Man kann geradezu schmecken, wie die Sorte geröstet wurde. Geschmacklich tendieren die Bohnen daher eher Richtung italienische Kaffeespezialität, was den Crema d'Oro Intensa zur idealen Grundlage für einen Espresso macht. Etwas mehr Vollmundigkeit wäre jedoch nicht schlecht gewesen.
1 Testbericht | 79 Meinungen

Typ: Kaffeebohnen; Würzig; Herkunft: Südamerika
Geschmacklich kann der Espresso von Coffee Circle gänzlich überzeugen. Er verfügt über ein kräftig würziges und volles Aroma, das auch fruchtig daher kommt. Die Arabica-Bohnen stammen aus Südäthiopien.
1 Testbericht | 51 Meinungen

Typ: Kaffeekapseln; Herkunft: Südamerika
Die Kapseln für das Cafissimo-System von Tchibo beinhalteten unter anderem chlorierte Verbindungen. Diese Stoffe belasten bei der Herstellung und Entsorgung die Umwelt und bilden bei der Verbrennung gesundheitsschädliche Dioxine. Des Weiteren fand man Nickel im Kaffeeaufguss. Für den Aspekt der Handhabung gab es ein „befriedigendes“ Urteil, da zum einen die Kapseln nicht automatisch ausgeworfen wurden und die Kapseln bei der Entnahme klemmten. Der Kaffee stammt aus nachhaltigem Anbau, was der Hersteller nachwies. Da es aber keine Mindestpreise für den Kaffee gab und die Kapseln ein Einwegprodukt darstellen, wurde der Aspekt der Produktion und Transparenz für „ausreichend“ erachtet.
1 Testbericht | 14 Meinungen

Typ: Kaffeebohnen; Würzig
„. Trotz des Namens - aus dem ‚Espresso Casa‘ wird auch ein passabler Kaffee. Die Mischung schmeckte kräftig, ein wenig unauffällig - ein erschwinglicher Kaffee für jeden Tag. Ein wenig mehr Körper . “
1 Testbericht | 20 Meinungen



Typ: Kaffeekapseln; Mild
Sensorische Beurteilung (60%): „gut“ (2,5); Probleme bei der Zubereitung (0%): keine; Schadstoffe (20%): „befriedigend“ (2,8); Verpackung (10%): „ausreichend“ (4,4); Deklaration (10%): …
2 Testberichte | 26 Meinungen

Typ: Kaffeebohnen; Mild
Mit Dallmayrs Crema d'Oro kann man nichts falsch machen. Er ist sozusagen eine Kaffeespezialität für jede Tageszeit. Das Aroma kann man als gut beschreiben und erfüllt die Bedürfnisse, die ein normaler Kaffeetrinker an das Schwarzgetränk stellt. In Form eines Espressos sind die Kaffeebohnen ebenfalls trinkbar. An eine klassische Espresso-Sorte reicht er jedoch nicht heran. Dafür fehlt einfach das überzeugend kräftige Aroma.
2 Testberichte | 78 Meinungen

Sensorische Beurteilung (60%): „befriedigend“ (3,0); Probleme bei der Zubereitung (0%): keine; Schadstoffe (20%): „befriedigend“ (2,7); Verpackung (10%): „befriedigend“ (3,0); Deklaration …
2 Testberichte | 9 Meinungen
Nespresso legt die Latte hoch
Testbericht über 14 Kaffeekapseln


Kaffeekapseln: Nestlé macht mit seinem Nespresso den besten Kaffee im Test. Doch die Konkurrenz zieht nach. Auch andere Anbieter verkaufen aromatischen Kaffee in Kapseln, darunter Lavazza und Senseo. Testumfeld: Die Stiftung Warentest nahm 14 Kaffeekapseln zur Zubereitung von Kaffee, … weiterlesen
Nicht immer Nespresso
Testbericht über 8 Kaffeekapseln


Also gut: Aus den Kapseln von Nespresso kommt der beste Kaffee. Doch unser Test von insgesamt 8 … weiterlesen
Hauptsache billig
Testbericht über 28 Lebensmittel aus 6 Discountern
Wer beim Discounter kauft, will sparen - aber nicht an der Qualität. Dass diese Rechnung nicht immer … weiterlesen
Produktwissen
Rezept des Monats: „Kaffee und Vanille fürs Grillfleisch“


Rösten und mörsern - so entstehen neue Würzmixturen fürs Fleisch. Ihr englischer Name Rubb bedeutet Abrieb. Dieser Beitrag aus der Zeitschrift test (5/2014) beinhaltet auf einer Seite Rezepte zu drei innovativen Würzmischungen für Grillfleisch. … weiterlesen
Die Entdeckung der Langsamkeit


Tropfen für Tropfen erobert eine alte Mode ihren Platz im Herzen der Kaffeeliebhaber zurück: … weiterlesen
Good morning, VIETNAM


Hätten Sie's gewusst? Der zweitgrößte Kaffeeexporteur der Welt heißt Vietnam. Hier trinkt man seinen … weiterlesen
Ratgeber zu Röstkaffees
Arabica oder Robusta?
 Bei der großen Vielzahl an verschiedenen Kaffeesorten im Handel mag so mancher glauben, dass es scheinbar ebenso viele verschiedene Bohnenarten gibt. Doch dem ist nicht so. Die meisten Geschmacksunterschiede bei Kaffee ergeben sich aus der Herstellungsmethode und insbesondere der Art der Bohnenröstung. Tatsächlich gibt es im Grunde nur zwei verschiedene Kaffeearten, die bei 96 bis 98 Prozent der weltweiten Produktion zur Verwendung kommen: Arabica und Robusta.
Bei der großen Vielzahl an verschiedenen Kaffeesorten im Handel mag so mancher glauben, dass es scheinbar ebenso viele verschiedene Bohnenarten gibt. Doch dem ist nicht so. Die meisten Geschmacksunterschiede bei Kaffee ergeben sich aus der Herstellungsmethode und insbesondere der Art der Bohnenröstung. Tatsächlich gibt es im Grunde nur zwei verschiedene Kaffeearten, die bei 96 bis 98 Prozent der weltweiten Produktion zur Verwendung kommen: Arabica und Robusta.
Dabei ist Arabica die wirtschaftlich bedeutendste Art der Gattung Kaffee. Rund 60 Prozent der Weltproduktion entfallen auf diese Pflanze. Ursprünglich aus Äthiopien stammend wird dieser Kaffee heute in vielen tropischen und subtropischen Ländern wie Südamerika und Zentral- sowie Ostafrika angebaut. Sein Vorteil ist insbesondere das intensive Aroma, das dem Robusta überlegen ist. Im Gegenzug ist der Arabica aber nichts für Morgenmuffel: Die Bohne enthält nur rund die Hälfte des Koffeins und besitzt damit eine weitaus schwächer belebende Wirkung.
Robusta gilt hingegen als die widerstandsfähigere von beiden Arten. Die zudem schneller wachsende und mehr Früchte tragende Kaffeeart macht derzeit zwischen 36 und 38 Prozent des Welthandels aus und wird vor allem in Schwarzafrika, Indien und Südostasien angebaut. Der Geschmack gilt als weniger edel und wird als „erdig“ bis „muffig“ beschrieben, doch der hohe Koffeingehalt macht diesen Kaffee als kraftvollen Muntermacher beliebt. Optisch können Robusta-Bohnen durch ihren geraden Einschnitt erkannt werden, wohingegen Arabica einen gewellten hat.
Eine hierzulande extrem seltene Ausnahme ist noch die Bohnenart Excelsa, die nur in sehr wenigen Sorten im Handel angeboten wird. Das Aussehen gleicht der Robusta-Pflanze, doch ist Excelsa von kräftigerem Wuchs und gedeiht auch auf kärgeren Böden. Das macht die Sorte zunehmend beliebt, dennoch macht ihr Anteil am Welthandel derzeit noch kaum 1 Prozent aus. Die Bohnen von Excelsa gelten als herber im Geschmack und enthalten noch mehr Koffein als sogar Robusta. Excelsa-Kaffee ist daher noch bitterer, wenngleich auch ohne das eher muffige Aroma der Robusta.
Produktwissen und weitere Tests zu Röstkaffees
Rezept des Monats: „Kaffee und Vanille fürs Grillfleisch“ test (Stiftung Warentest) 5/2014 - Rösten und mörsern - so entstehen neue Würzmixturen fürs Fleisch. Ihr englischer Name Rubb bedeutet Abrieb. Dieser Beitrag aus der Zeitschrift test (5/2014) beinhaltet auf einer Seite Rezepte zu drei innovativen Würzmischungen für Grillfleisch.
Good morning, VIETNAM Coffee 2/2012 - Hätten Sie's gewusst? Der zweitgrößte Kaffeeexporteur der Welt heißt Vietnam. Hier trinkt man seinen Muntermacher stark, würzig - und auf Eis. Auf diesen 4 Seiten befasst sich die Zeitschrift Coffee (2/2012) mit der Kaffeekultur in Vietnam und zeigt in fünf Schritten, wie ein Vietnam-typischer Kaffee entsteht.
Die Entdeckung der Langsamkeit Coffee 2/2012 - Tropfen für Tropfen erobert eine alte Mode ihren Platz im Herzen der Kaffeeliebhaber zurück: das Handfiltern. Wer mitmachen will, braucht einen Porzellanfilter, Filterpapier und frisch gemahlenen Kaffee.
Café Träume Coffee 1/2012 - Abschalten. Entspannen. Kaffee trinken. Nachdenken. Wo geht das am besten? In einem schönen Café. Wir zeigen vier wunderbare Kaffeehäuser.
Nicht immer Nespresso Konsument 11/2015 - Auch Furan bildet sich im Röstprozess - und ist eine Aromakomponente. Je aromatischer der Kaffee, desto mehr Furan enthält er. Das Problem: Furan gilt für Menschen als möglicherweise krebserregend. Bei der Kaffeezubereitung geht Furan aus dem Kaffeemehl in den Aufguss über - bei der Verwendung von Kaffeevollautomaten oder Kapselmaschinen, also bei geschlossenen Systemen, mehr als bei herkömmlichen Kaffeemaschinen oder händisch aufge gossenem Kaffee.
Die neue Senseo Twist verwöhnt Augen und Gaumen Technik zu Hause.de 2/2012 - Neu ist, dass man diesen zur Reinigung ganz einfach abneh men und soga r im Geschi r rspüler reinigen kann. Gleiches gilt für die Abtropfschale. Der in den Deckel integrierte Öffnungsmechanismus macht den Pad-Wechsel zum Kinderspiel. Auf leichten Dr uck springt der Deckel auf. Mit Hilfe des Touch-Displays wählt der Nutzer zwischen einer oder zwei Tassen und den drei voreingestellten Kaffeestärken.
Der Traum vom perfekten Espresso Coffee 2/2012 - Und dann der Anblick der Maschine: ein großer Drehregler, Chrom, Kippschalter, die massive Brühgruppe. Hier schreit alles nach Benutzung. Das ist es, was die Faszination einer Siebträgermaschine ausmacht. Es ist das Erfahren von Handarbeit, das Bewusstsein, dass dieser Cappuccino oder dieser Espresso von mir stammt. Der Mensch braucht Projekte, sagt eine aktuelle Baumarktwerbung. Beim Kaffee ist das nicht anders.
Coffee Dreams Coffee 2/2012 - Dazu ein Brioche oder ein Stück Obsttarte aus der hauseigenen französischen Backstube. Sie stehen in Schlangen an den zwei Kaffeeausgaben, die eine mit, die andere ohne Kuchentheke, und wählen unter vier Kaffeesorten und sechs Zubereitungsarten. Ruhe und Gemütlichkeit sehen anders aus. Die Freiburger wollen Kaffee, und den bekommen sie. Gut, schlicht, schnell. Einen italienischen Mauro, einen Schweizer Koianda, einen deutschen IO oder einen fair gehandelten Kaffa.
Geröstet - oder geröstet? Coffee 2/2012 - Es bedarf der Erfahrung des Röstmeisters, um zu wissen, welche Sorten einzeln oder gemeinsam geröstet werden und welche in der richtigen Folge dann zum Blend zusammengeführt werden. Wie kann der Röster eine gleichbleibende Qualität im Einkauf sicherstellen? Man hat ja seine Kaffeemischungen und ordert hierzu den Rohkaffee. Man erhält Rohkaffeemuster, die man auf Bohnenfarbe, Größe und andere Faktoren überprüft. Man macht eine Proberöstung mit einer Verkostung.
Neue, alte Süße Coffee 1/2012 - Aber auch derartige Limonaden erzeugen kein Sättigungsgefühl. Der Hunger bleibt also. Wir empfehlen als Durstlöscher Getränke, die von vornherein ungesüßt sind, wie Wasser, Tee, Fruchtsäfte und auch - in Maßen - Kaffee. Früher galt Kaffee als Flüssigkeitsräuber. Heute wissen wir, dass der Organismus sehr wohl auf den Flüssigkeitsverlust durch Kaffeeeinwirkung ausgleichend reagieren kann. Das obligatorische Glas Wasser zum Kaffee darf dennoch bleiben.
Senseo Viva Café Eco: Aus Recycling-Materialien Technik zu Hause.de 1/2012 - Und selbst die Ver packung hat zu 90 Prozent bereits ein Vorleben gehabt. Um ihrem grünen Ruf gerecht zu werden, schaltet die Senseo Viva Cafe Eco nach fünf Minuten Betrieb oh ne Ka ffeebezug automatisch ab. Die Technik ist die gleiche wie bei den bereits bekannten Modellen. Aus 16 unterschiedlichen Kaffeepad-Va r iationen br üht die Senseo in kürzester Zeit frischen Kaffee mit feiner Crema. Unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf passen verschiedene Gläser und Tassen.
Tierischer Kaffee Coffee 3/2011 - Der Aufwand lohnt sich, denn das Produkt ist bei Vegetariern und Naturliebhabern begehrt. Der Jacu Bird Coffee ist sowohl Bio- als auch Demeter-zertifiziert. Wegen seiner extrem geringen Erntemenge gilt er als eine absolute Exklusivität: Jährlich gelangen nur etwa 100 Kilogramm auf den Markt. Den Jacu Coffee vertreibt Badilatti erst seit August. Der Geschmack gilt als süßlich, vollmundig, mit etwas Säure. „Ungewöhnlich fruchtig, mit einer leichten Schwarzbrotnote“, wie Experten sagen.
Empfehlung unserer Leser Weitere Informationen zum Thema Röstkaffees finden Sie auch bei swr.de . Senden Sie uns weitere Vorschläge für hilfreiche Seiten.
Benachrichtigung Wir benachrichtigen Sie kostenlos bei neuen Tests zum Thema Röstkaffees. Abschicken
Комментариев нет:
Отправить комментарий