Kein Kaffee bei Antibiotika-Einnahme
Wer ein Antibiotikum einnehmen muss, soll in dieser Zeit koffeinhaltige Getrдnke wie Kaffee oder Cola meiden, und keinesfalls das Medikament damit herunter spьlen, rдt das Gesundheitsmagazin Apotheken Umschau.
Manche Antibiotika verstдrken die Koffeinwirkung so sehr, dass es zu Herzflattern, Kopfschmerzen und Schwindel kommen kann. Zum Herunterspьlen eignet sich am besten Leitungs- oder Tafelwasser, nicht aber kalziumreiches Mineralwasser.
Kalzium, auch reichlich in Milch vorhanden, bindet einige Antibiotika und macht sie unwirksam. Auch Sдfte sind manchmal problematisch. So kann Grapefruitsaft im Zusammenspiel mit Antibiotika starken Durchfall verursachen.
Kategorien:
Quellenangaben zeigen
- Gesundheitsmagazin Apotheken Umschau 3/2005 B
Paradisi-Redaktion - News vom 31.03.2005
Weitere News zum Thema
Mehr Krankheitserreger resistent gegen Antibiotika
Die beiden Gesellschaften fьr Mikrobiologie in Deutschland warnen vor einer steigenden Resistenz von Erregern gegen Antibiotika. Experten sagt.
Nahrungsbestandteile kцnnen Arzneimittel verдndern
Wenn Kleinkinder ein Medikament benцtigen, ist die Versuchung groЯ, es mit ins Flдschchen zu geben. Davon ist aber grundsдtzlich abzuraten, sc.
Durch Katzenkratzkrankheit monatelang dicke Lymphknoten
Katzen kцnnen eine unangenehme Infektionskrankheit ьbertragen: die Katzenkratzkrankheit (KKK). Obwohl sie nicht gefдhrlich ist, fьhrt sie nich.
Keine Antibiotika in die Hausapotheke
Antibiotika gehцren nicht in die Hausapotheke. Die gegen Infektionen durch bakterielle Erreger wirksamen Mittel mьssen bei jeder Erkrankung sp.
Neue Aufgabe fьr Penicillin?
Penicillin und mit ihm verwandte Antibiotika („Beta-Lactam- Antibiotika“) kцnnten fьr neue Aufgaben geeignet sein. Forscher der Johns-Hopkins-.
Antibiotika
Ьbersicht zum Thema Antibiotika
Relevante Kategorien
Auch das kцnnte Sie interessieren
Pflanzliche Antibiotika - Aloe Vera, Grapefruitkern-Extrakt, Knoblauch und Thymian
Herstellungsweise, Inhaltsstoffe und Wirkung von Medikamenten und verschiedene Formen der Behandlung
Antibiotika - Anwendung, Wirkung und Nebenwirkungen
News zum Thema
Aktuelle Beitrдge zum Thema
Schlagwцrter
-
Ressorts
- Wellness
- Beauty & Pflege
- Health & Ernдhrung
- Fitness & Sport
- Freizeit & Erholung
-
Community
- Community-Startseite
- Forenьbersicht
- Forenarchiv
- Mitgliederьbersicht
- Registrieren
-
Service
- Branchensuche
- Schlagwцrter
- Themen
- Sitemap
- Nьtzliche Seiten
-
Paradisi
- Ьber uns
- Werbung
- Partner
- Datenschutz
- Impressum
-
Folgen
Wir befolgen den HONcode Standard fьr vertrauenswьrdige Gesundheitsinformationen.
Darf man bei Antibiotikum Kaffee trinken?
Ich musste letzten Antibiotika einnehmen und habe auch Kaffee getrunken. Kann das gefährlich werden
3 Antworten

Das hängt auch davon ab, welches Antibiotikum man nehmen muss.
Wahrend man mit Gyrasehemmern behandelt wird, sollte man auch generell auf Kaffee, Tee und Cola verzichten. Das Medikament verstärkt die anregende Wirkung von Koffein, was zu Schlaflosigkeit, innerer Unruhe, heftigem Herzklopfen u.Ä., führen kann. Insbesondere Patienten, die zu Krampfanfällen neigen oder an Herzrythmusstörungen leiden, sollten in dieser Hinsicht vorsichtig sein. Auch auf Alkohol verzichtet man besser, wenn man ein Antibiotikum einnimmt

Ja,aber Milch sollte man erst ca. 2 Stunden danach trinken. LG gadus

Kaffe ist Ok. ! Nur keinen Alkohol sollte man in so einem Fall nicht trinken !
Risiko Nahrungsmittel – Wechselwirkungen mit Medikamenten

Eine Reihe von Medikamenten verträgt sich nicht mit bestimmten Nahrungsmitteln. Werden zum Beispiel Antibiotika gleichzeitig mit Milchprodukten eingenommen, verlieren sie an Wirkung. Mehr als 300 Arzneimittel können weniger effektiv oder sogar giftig werden, wenn sie mit gewissen Lebensmitteln zusammen eingenommen werden.
Wechselwirkungen von Medikamenten – Zahlen und Fakten
Jeder Deutsche schluckt durchschnittlich 1.250 Tabletten und andere Medikamente pro Jahr – und das fast immer, ohne darüber nachzudenken, womit er sie herunterschluckt, mal mit Milch, mal mit Kaffee, mal gar mit Bier und nicht selten zusammen mit einer kompletten Mahlzeit. Nach Angaben des deutschen Apothekerverbandes reagieren mehr als 315 Arzneistoffe auf Lebensmittel.
Diese Substanzen stecken in über 5.000 gängigen Medikamenten. Das bedeutet: bei 12,5 Prozent der Medikamente kann es in Verbindung mit Lebensmitteln zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Nicht immer geben Ärzte ihren Patienten zusammen mit dem Rezept auch Ernährungsempfehlungen, die bei der Einnahme des Medikaments zu beachten sind.
Häufige Wechselwirkungen
Meist jedoch ist die Wechselwirkung nicht allzu dramatisch, wenn man z.B. nur gelegentlich ein Kopfschmerzmittel schluckt. Als gefährdet gelten Patienten und chronisch Kranke, die bis zu zehn verschiedene Medikamente täglich verabreicht bekommen. Damit steigt das Risikopotenzial immens an, berichtet das unabhängige britische Committee on Toxicity.
Manchmal wirkt ein Medikament einfach nicht mehr so gut, wenn es zusammen mit bestimmten Nahrungsmitteln in den Körper gelangt. Gelegentlich blockieren Arzneien im Darm die Aufnahme von wichtigen Substanzen, wie beispielsweise Calcium, Fluor oder Jod. In seltenen Fällen drohen durch die Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Nahrung sogar Schlafstörungen und Herzrasen.
Hier sind die häufigsten Wirkungen der gebräuchlichsten Medikamente aufgelistet:
Unproblematisch: Blutgerinnungshemmer und grünblättriges Gemüse
Als unproblematisch gelten nach neueren Untersuchungen und entgegen vieler Informationen häufig verordnete Mittel zur Blutverdünnung, sogenannte Antikoagulantien wie Marcumar, um zum Beispiel einer Thrombose vorzubeugen. Vitamin K ist in grünblättrigem Gemüse (Kohl, Spinat, Kohlrabi, Kopfsalat, Sauerkraut ) sowie in Leber, Fleisch und Ei enthalten.
Solche Vitamin-K-haltigen Lebensmittel braucht man nicht zu meiden, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): "In einer Reihe von klinischen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass selbst durch Verzehr größerer Mengen an Vitamin-K-reichen Lebensmitteln der Quick-Wert nicht oder nur unwesentlich beeinflusst wird. Für Patienten unter Antikoagulationstherapie mit Vitamin-K-Antagonisten gibt es daher keinen Grund, auf Vitamin-K-reiche Lebensmittel, wie Leber, Spinat, Brokkoli, Weiß-, Rot-, Grün- und Blumenkohl, zu verzichten."
Sinnvoll aber ist es auf entsprechende Multivitaminpräparate zu verzichten bzw. deren Einnahme ist mit dem behandelnden Arzt zu klären.
Tipps zur Einnahme vom Arzneimitteln
Auf den Beipackzetteln finden sich die Hinweise, wann die Medikamente eingenommen werden sollen. Heißt es "Einnahme vor dem Essen", dann sollte die Arznei 60 bis 30 Minuten vor der Mahlzeit eingenommen werden. "Einnahme während des Essens" bedeutet, Einnahme innerhalb von fünf Minuten nach der Mahlzeit. "Einnahme nach dem Essen": zwischen Mahlzeit und Einnahme sollte ein Abstand von 30 bis 60 Minuten liegen.
Medikamente sollten immer mit ausreichend Flüssigkeit, am besten reinem Wasser, eingenommen werden. Alkoholische Getränke sollte man grundsätzlich meiden, wenn man Medikamente verordnet bekommen hat. Bei Beruhigungsmitteln oder Blutdruckmedikamenten kann die Wirkung verstärkt werden: Alkohol fördert auch die Aufnahme der Medikamente und erhöht deren Wirksamkeit. Warnhinweise auf den Arzneimittel-Beipackzetteln sind daher unbedingt zu beachten, da zum Beispiel das Reaktionsvermögen schon bei geringem Alkoholkonsum stark reduziert sein kann.
Fruchtsäfte und Limonaden trink man am besten erst eine halbe Stunde nach Medikamenteneinnahme. Bei Antibiotika sollten zwischen Einnahme und dem Genuss von Milch mindestens zwei Stunden liegen. Auch bei Eisenpräparaten sollten weder Milch, Sahne, noch Rhabarber oder eiweißreiche Produkte verzehrt werden.
Fragen Sie den Arzt oder Apotheker
Die meisten Menschen müssen sich allerdings kaum bei ihrer Diät umstellen, wenn sie Arzneimittel einnehmen, bilanziert der Bericht des Committee on Toxicity. Zahlreiche Wechselwirkungen wie etwa die verminderte Wirkung von Antibiotika bei gleichzeitigem Genuss von Milchprodukten sind auf den meisten Gebrauchsanweisungen der Medikamente beschrieben.
Die Experten raten jedoch dringend, vor dem Einnehmen von Arzneimitteln die Gebrauchsinformationen unter dem Stichwort "Wechselwirkungen" genau zu lesen. Im Zweifel sollte vor allem bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten der Apotheker konsultiert werden. Ärzte sollten sich genau über die Ernährungsgewohnheiten ihrer Patienten informieren, ehe sie Arzneimittel verschreiben.
Herzflattern und Schwindel drohen: Kein Kaffee bei Antibiotika-Einnahme
Wählen Sie, welchen Ressorts, Themen und Autoren dieses Artikels Sie folgen möchten. Entsprechende Artikel finden Sie dann auf „Mein RP ONLINE“
Herzflattern und Schwindel drohen
Baierbrunn (rpo). Wer ein Antibiotikum einnehmen muss, soll in dieser Zeit koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder Cola meiden, und keinesfalls das Medikament damit herunter spülen. Das rät das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".
Manche Antibiotika verstärken die Koffeinwirkung so sehr, dass es zu Herzflattern, Kopfschmerzen und Schwindel kommen kann.
Zum Herunterspülen eignet sich am besten Leitungs- oder Tafelwasser, nicht aber kalziumreiches Mineralwasser. Kalzium, auch reichlich in Milch vorhanden, bindet einige Antibiotika und macht sie unwirksam.
Auch Säfte sind manchmal problematisch. So kann Grapefruitsaft im Zusammenspiel mit Antibiotika starken Durchfall verursachen.
Darf man Kaffee trinken, wenn man Antibiotika einnimmt?
Ich nehme wegen einer Grippe derzeit Antibiotika und mein Freund sagte, dass man während dessen keinen Kaffee trinken darf. Stimmt dies?
8 Antworten

"Bestimmte Antibiotika (Tetracycline und Gyrasehemmer) haben eine erheblich verminderte Wirksamkeit, wenn sie zusammen mit Milch, Joghurt, Käse und Quark eingenommen werden. Zwei Stunden Abstand sollten mindestens zwischen Milchverzehr und Antibiotikaeinnahme liegen. Wahrend man mit Gyrasehemmern behandelt wird, sollte man auch generell auf Kaffee, Tee und Cola verzichten. Das Medikament verstärkt die anregende Wirkung von Koffein, was zu Schlaflosigkeit, innerer Unruhe, heftigem Herzklopfen u.Ä., führen kann. Insbesondere Patienten, die zu Krampfanfällen neigen oder an Herzrythmusstörungen leiden, sollten in dieser Hinsicht vorsichtig sein. Auch auf Alkohol verzichtet man besser, wenn man ein Antibiotikum einnimmt."

Koffein ist während der Einnahme von Antibiotika eigentlich generell zu meiden. Eine Missachtung kann zu Erregungszuständen, Herzrasen und Schlafstörungen führen. Insofern hat dein Freund Recht, ich hoffe ihr habt um nichts gewettet.

. wirklich so schlimm? Ich bin so ziemlich kaffeesüchtig. Da Antibiotika sowieso alles zerstört (sowohl die gute, als auch die dunkle Seite der Macht), hab ich gedacht - das wäre Wurst
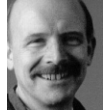
WECHSELWIRKUNGEN. Ich denke, dass sich diese Probleme verschärfen, weil immer mehr Menschen mehrere Präparate gleichzeitig einnehmen. Kaffee ist kein Medikament, kann in diesem Zusammenhang aber doch zu gewissen Interaktionen führen, wodurch der Abbau oder die Ausscheidung bestimmter Stoffe verlangsamt wird. Wenn Du das Gefühl hast, dass du Kaffee zusammen mit dem Antibiotikum nicht gut verträgst, würde ich eher auf Kaffee verzichten.

Ich denke schon.. ist mir jedenfalls kein Verbot bekannt

Ich nehme auch Antibiotika und trinke Kaffee dazu. Um ehrlich zu sein, auch ab und an ein Gläschen Bacardi-Cola. Alles in bester Ordnung mit mir :)
mir völlig high versuch auf die Schulter zu tätscheln

Kaffe schon, Alkohol solltest vermeiden

Ja Klar, Außer Wenn In Der Packungsbeilage Etwas Anderes Steht
Antibiotika kaffee
Diese Frage ist gespeichert in:
Ähnliche Fragen
Neueste Antworten
Das könnte Dich auch interessieren:
Antwort: Kaffee Robusta ist schärfer gebrannt und Kaffee Arabica ist eine Bestimmte Kaffeesorte. . Antwort ansehen
Antwort: Löslicher Kaffee oder Instantkaffee (von englisch instant coffee) ist ein koffeinhaltiges, wasserlösliches Getränkepulver. Durch Aufgießen dieses Pulvers mit Wasser entsteht ein kaffeeähnliches Getränk.http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6slicher_Kaffee . Antwort ansehen
Antwort: Damit der befeuchtete Kaffeefilter überall gleichmäßig anliegt. . Alle Antworten ansehen
Antwort: Koffein wird eine die Peristaltik anregende Wirkung zugeschrieben. . Alle Antworten ansehen
Ähnliche Frage
- Gibt es Instant Coffee ohne Zucker?
Dann stelle Deine Frage doch schnell und kostenlos!
Antibiotika richtig einnehmen

Nehmen Sie Antibiotika am besten mit einem großen Glas Wasser ein
Entzündete Blase, vereiterte Mandeln, gefährliche Lungenentzündung – das sind typische Einsatzgebiete von Antibiotika. Die Mittel helfen immer dann, wenn Bakterien im Körper eine Infektion ausgelöst haben. Denn die Arzneien töten die Krankheitserreger ab oder verhindern zumindest, dass sich die Keime vermehren. Ein Antibiotikum kann die Bakterien allerdings nur bekämpfen, wenn Sie es richtig anwenden.
Zeitabstände einhalten, Einnahme nicht zu früh abbrechen
Verschreibt Ihnen der Arzt ein Antibiotikum, sagt er normalerweise dazu wie oft und wie lange Sie es anwenden sollen. Manchmal schreibt er das auch nur aufs Rezept. Haben Sie nicht im Kopf, wie Sie das Mittel einnehmen sollen, dann fragen Sie in der Apotheke oder beim Arzt nach. Tipp: Lassen Sie sich die Einnahmehinweise in der Apotheke auf die Medikamentenschachtel schreiben.

Unser Experte: Dr. Frank Hommel, Apotheker aus Havelberg
Es ist wichtig, das Mittel so einzunehmen wie verordnet, weil nur dann eine ausreichend hohe Konzentration des Arzneistoffs im Körper vorhanden ist. "Ein gleichbleibender Wirkstoffspiegel im Blut ist für den Therapieerfolg entscheidend", sagt Dr. Frank Hommel, Apotheker aus Havelberg. Kann das Antibiotikum nicht seine volle Wirkung entfalten, "können widerstandsfähige Bakterien überleben und gegen das Medikament unempfindlich werden", erklärt Hommel, der auch Mitglied in der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker ist. Das gleiche kann passieren, wenn Sie das Mittel nicht lange genug anwenden.
Spricht der Arzt von "1x1 täglich", dann bedeutet das: Etwa alle 24 Stunden die Tablette oder die Creme anwenden. Mit "2x1 pro Tag" ist gemeint, das Präparat im Abstand von zirka 12 Stunden zu verwenden. "3x1 am Tag" heißt, ungefähr alle acht Stunden nehmen. Ebenfalls wichtig: Lesen Sie im Beipackzettel nach oder fragen Sie in der Apotheke, wie Sie die Tabletten oder Kapseln schlucken sollen. Empfiehlt der Hersteller, das Antibiotikum "vor dem Essen" einzunehmen, dann nehmen Sie es eine halbe bis ganze Stunde davor. "Zum Essen" steht für: direkt zur Mahlzeit.
Achtung, Wechselwirkungen möglich!
Möglicherweise möchten Sie das Mittel trotz eines abweichenden Hinweises zum oder nach dem Essen schlucken, weil Sie das Antibiotikum so besser vertragen. Dann kann es allerdings passieren, dass die Tablette nicht mehr so gut hilft. "Manche Wirkstoffe werden schlechter aufgenommen, wenn Sie sie zum Essen einnehmen", meint Hommel.
Nehmen Sie die Tablette vorzugsweise mit einem großen Glas Leitungswasser ein – nicht nur mit einem Schluck davon! Sonst kann sich das Arzneimittel in der Speiseröhre verfangen. Milch, Tee oder Kaffee eignen sich weniger, "weil sich dabei schwerlösliche Komplexe im Magen bilden können, welche die Aufnahme des Medikaments behindern", rät der Apotheker. Dasselbe gilt, wenn Sie gleichzeitig magensäurebindende Mittel anwenden, die sogenannten Antazida, oder Mineralstoffpräparate, die zum Beispiel Kalzium, Magnesium oder Zink enthalten.
Manche Antibiotika gehen teils gefährliche Wechselwirkungen mit anderen Arzneien ein. Ein Beispiel: Makrolid-Antibiotika wie Erythromycin und Statine, die bekannten Cholesterinsenker. Die Wirkung des Statins wird verstärkt, was Nebenwirkungen wie Muskelschmerzen begünstigen kann. Weitere Beispiele: Manche Antibiotika lösen Zuckerschwankungen bei Diabetikern aus, andere erhöhen die Blutungsneigung bei gleichzeitiger Gabe von Phenprocoumon. Der verhütende Effekt der Pille kann durch Einnahme von Antibiotika nachlassen, was zu einer ungewollten Schwangerschaft führen kann. Klären Sie vorab mit Arzt und Apotheker, ob Ihr Antibiotikum von solchen Wechselwirkungen betroffen ist und wie Sie sich dann am besten verhalten.
Mögliche Nebenwirkungen: Durchfall, Pilze und Allergien
"Im Allgemeinen sind Antibiotika gut verträglich", sagt Hommel. Dennoch weist der Apotheker auf potenzielle Nebenwirkungen hin: Allergien auf das Mittel seien möglich, ebenso Hautausschläge, ausgelöst durch das Medikament. Daneben leiden einige Menschen unter Durchfall. Denn das Antibiotikum bekämpft nicht nur die krankmachenden Bakterien, es kann auch die gesunde Darmflora schädigen. Probiotika, die Bakterienkulturen enthalten, können die Flora wieder aufbauen.
Frauen bekommen manchmal einen Scheidenpilz, weil die natürliche Scheidenflora durch das Antibiotikum aus dem Gleichgewicht gerät. Einige Mittel erhöhen die Lichtempfindlichkeit. Das heißt, Sie können schneller einen Sonnenbrand erleiden. Wichtig: Vertragen Sie das Medikament nicht gut, dann setzen Sie es nicht eigenmächtig ab. Besprechen Sie stattdessen umgehend mit dem Arzt, was Sie tun können.
Lesen Sie auch:

2 Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier noch einmal auf das Icon klicken, wird Ihre Empfehlung gesendet.
Weitere Online-Angebote des Wort & Bild Verlages
Krankheiten, gesund alt werden, altersgerechtes Wohnen, Pflege und Finanzen
Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2: Symptome, Behandlung und Ernährung bei Zuckerkrankheit
Schwangerschaft, Geburt, Vorsorge, Kinderkrankheiten, Homöopathie und Erziehung
Antibiotika: Richtige Einnahme

Das Wort Antibiotika stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt "gegen das Leben". Doch geht es nicht dem, der sie einnimmt an den Kragen, sondern den Keimen, die ihm das Leben schwer machen. Antibiotika sind nach wie vor eine Wunderwaffe, die Leben retten können. Allerdings müssen sie dafür richtig eingesetzt werden.
Wie Antibiotika gegen Bakterien wirken
Es gibt zahlreiche Mikroorganismen, die Infektionen verursachen – vor allem Bakterien und Viren, aber auch Pilze und andere. Doch Antibiotika wirken ausschließlich gegen Bakterien! Das liegt daran, dass Bakterien und Viren sehr unterschiedlich sind. So werden Bakterien bis zu 0,002 mm groß, haben einen eigenen Stoffwechsel und können auf künstlichen Nährböden gezüchtet werden. Viren dagegen sind ungefähr hundert Mal kleiner als Bakterien und können nicht selbstständig existieren, sie sind auf so genannte Wirtszellen angewiesen.
Antibiotika greifen unter anderem an der Zellwand oder dem Stoffwechsel der Bakterien an – gegen Viren dagegen, die sich in den menschlichen Zellen einnisten, können sie nichts ausrichten. Wichtig ist dieses Wissen vor allem im Zusammenhang mit Erkältungskrankheiten: Diese werden überwiegend durch Viren verursacht – und dann helfen keine Antibiotika.
Einnahme von Antibiotika
Ganz wichtig: Ein Antibiotikum muss immer bis zum Schluss der vorgegebenen Einnahmezeit aufgebraucht werden. Die verordnete Anwendung, enthaltene Wirkstoffmenge und Einnahmezeit sind dabei vom Arzt auf die vorliegende Infektion und möglicherweise vorhandene Allergien und Begleiterkrankungen abgestimmt. Tritt nach den ersten Tagen eine Besserung ein, deutet dies darauf hin, dass das Antibiotikum gut wirksam ist. Dennoch muss die Arznei immer so lange eingenommen werden, wie der Arzt es verordnet hat. Nur so werden wirklich alle Bakterien zerstört und Resistenzen der Keime vermieden. Weitere wichtige Einnahmevorschriften sind:
- Die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Einnahmen muss eingehalten werden. Nur so ist gewährleistet, dass der Wirkstoffspiegel im Körper konstant hoch gehalten wird. "Dreimal täglich" bedeutet also: alle acht Stunden eine Dosis.
- Antibiotika mit Wasser einnehmen. Antibiotika sollten mit Wasser eingenommen werden, denn Milch oder andere Lebensmittel können die Wirkung vermindern. Empfohlen wird ein ganzes Glas Wasser zu trinken. Zwischen dem Genuss von Milch/Milchprodukten und der Antibiotika-Einnahme sollten mindestens zwei Stunden liegen.
- Genauer Einnahmezeitpunkt. Inzwischen gibt es unterschiedliche Wirkstoffgruppen von Antibiotika. Aus diesem Grund kann es auch keine allgemein gültigen Regeln zum Einnahmezeitpunkt geben. Einige Antibiotika müssen nüchtern eingenommen werden, andere wiederum zum Essen. Wann genau Ihr Medikament eingenommen werden soll, sagt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker; Sie finden diese Information auch auf dem Beipackzettel.
- Wechselwirkungen. Wer zusätzlich andere Medikamente einnimmt, sollte wegen möglicher Wechselwirkungen beim Arzt nachfragen.
Große Tabletten besser schlucken
Antibiotika - vor allem in höheren Dosierungen - sind oft sehr groß und dürfen häufig, z. B. wegen bestimmter Tablettenüberzüge, nicht zerkleinert werden (lässt sich der Packungsbeilage entnehmen).
Vielen Menschen fällt es jedoch schwer, große Tabletten zu schlucken. Falls sich die Anwendung nicht auf eine andere Zubereitungsart wie Saft umstellen lässt, helfen einige Tricks:
- Bereits vor der Einnahme einen Schluck Wasser trinken, damit die Schleimhaut gut befeuchtet wird.
- Anschließend die Tablette so weit wie möglich nach hinten auf die Zunge legen und mit einem ganzen Glas Wasser herunterspülen.
- Den Kopf beim Schlucken leicht nach vorn (!) neigen.
Nebenwirkungen: Antibiotika und Durchfall
Antibiotika können durch ihre Wirkungsweise auch Nebenwirkungen verursachen. Für den Menschen nützliche Bakterien leben z. B. in der Mundhöhle, aber auch in unserem Darm. Dort sorgen sie dafür, dass die Nahrung richtig verdaut wird. Wer ein Antibiotikum einnehmen muss, bekämpft damit nicht nur die gefährlichen, sondern auch die nützlichen Bakterien. So kann z. B. die Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten. Störungen wie weiche Stühle oder gar Durchfall sind unter der Einnahme von Antibiotika nicht selten zu beobachten.
Normalerweise wird nach Beendigung der Therapie schnell wieder eine normale Darmfunktion erreicht. Wer jedoch Probleme hat, kann zur Regeneration der Darmflora in der Apotheke spezielle Präparate erwerben, z. B. Hefekulturen aus Saccharomyces boulardii oder Bakterienextrakten aus Lactobacillus, Bifidobacterium und Escherichia coli.
Entsorgung von Antibiotika
Bewahren Sie keine angebrochenen Packungen von Antibiotika auf! Zum einen gibt es unterschiedliche Bakterien, die auch mit unterschiedlichen Wirkstoffen therapiert werden; zum anderen wird eine angebrochene Packung den oben genannten Einnahmekriterien nie gerecht werden. Es gilt also: Infekte von einem Arzt abklären lassen; Antibiotika nicht einfach auf Verdacht einnehmen!
Antibiotikaresistenz
Bei vielen Bakterien wirken Antibiotika nicht mehr. Der Grund: die Erreger sind gegen die Arzneimittel resistent geworden. Schuld daran ist in vielen Fällen ein zu sorgloser Umgang mit Antibiotika. Wenn z. B. das Medikament vorzeitig abgesetzt wird oder der Patient sich nicht an die Einnahmevorschrift hält, können widerstandsfähige Bakterien überleben und gegen das Mittel resistent werden, also unempfindlich gegen das Antibiotikum. Deshalb ist es gerade bei Antibiotika so wichtig, die vorgeschriebene Menge im richtigen Abstand über den festgelegten Behandlungszeitraum einzunehmen.
- Antibiotika regelmäßig und in ausreichender Dosis nehmen
- Antibiotikum nicht zu früh absetzen.
- Keine Selbsttherapie mit Antibiotika.
Autor/Quelle: Dagmar Reiche
Allgemeines zum Thema

Breitbandantibiotikum Amoxicillin
Das Antibiotikum Amoxicillin wird zur Behandlung von verschiedenen bakteriellen Infektionen eingesetzt. Wie andere Medikamenten hat auch Amoxicillin Nebenwirkungen: Zu den häufigsten Nebenwirkungen. mehr

Antibiotikum Ciprofloxacin
Das Antibiotikum Ciprofloxacin wird zur Behandlung von bakteriellen Infektionen wie Blasen- oder Nierenbeckenentzündungen eingesetzt. Erfahren Sie hier, welche Nebenwirkungen während der Behandlung. mehr
Der richtige Umgang mit Antibiotika
Der richtige Umgang mit Antibiotika
Bildquelle: colourbox.de/picture-alliance/Kombo: ARD.de
Der richtige Umgang mit Antibiotika
An Antibiotika scheiden sich die Geister: Für die einen sind sie eine Wunderwaffe, die Leben rettet. Die anderen sehen sie eher kritisch, weil sie häufig zu Resistenzen führen, die lebensbedrohlich werden können. Die wichtigsten Fragen zum Umgang mit Antibiotika.
Was sind Antibiotika?
Antibiotika sind natürlich gebildete Stoffwechselprodukte von Pilzen und Bakterien. Das Wort Antibiotika stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt "gegen das Leben". An den Kragen geht es aber letztlich nur Bakterien. Sie werden in ihrem Wachstum gehemmt oder abgetötet. Zur Arzneimitteltherapie verwendet man heute Antibiotika, die entweder synthetisch oder biotechnologisch gewonnen werden.
Wozu dienen sie?
Antibiotika werden zur Bekämpfung von Infektionen eingesetzt, die durch Bakterien verursacht werden. Bakterien kommen praktisch überall und in unzähligen Arten und Formen vor. Sie machen uns aber nicht alle krank. Viele sind sogar ausgesprochen nützlich. Sie leisten uns z.B. gute Dienste bei der Verdauung.
Weil Antibiotika nicht zwischen "guten" und "schlechten" Bakterien unterscheiden können, töten sie leider auch die nützlichen ab. Das kann zum Beispiel die Darmflora aus dem Gleichgewicht bringen.
Welche Antibiotika gibt es?
Es gibt es eine Vielzahl von antibiotischen Substanzen. Die wichtigsten sind:
- Penicilline mit breitem Wirkspektrum
- Penicilline mit schmalem Wirkspektrum
- Cephalosporine
- Sulfonamid-Kombinationen
- Tetrazykline
- Makrolide
- Aminoglykoside
- Gyrasehemmer
Warum helfen Antibiotika nicht gegen Erkältungen?
Erkältungskrankheiten wie auch die Grippe sind Virusinfektionen. Gegen Viren sind Antibiotika absolut machtlos. Das liegt daran, dass Antibiotika in den Stoffwechsel der Bakterien eingreifen. Viren hingegen haben gar keinen eigenen Stoffwechsel, sondern bedienen sich zur Vermehrung einer Wirtszelle. Sie bieten den Antibiotika praktisch keinen Angriffspunkt.
Trotzdem kann es auch bei einer Erkältung nötig werden, dass der Arzt ein Antibiotikum verschreibt. Das ist immer dann der Fall, wenn es im Laufe einer Erkältungskrankheit zu einer zusätzlichen Infektion mit Bakterien kommt. Mediziner nennen das eine Superinfektion. Typische Beispiele hierfür sind der eitrige Schnupfen, die Nasennebenhöhlenvereiterung nach einem Schnupfen oder Halsschmerzerzen mit hohem Fieber und eitrigem Auswurf. Sind Bakterien beteiligt, handelt es sich meist um Streptokokken, die schwere Folgeschäden verursachen können, z.B. am Herzen oder den Nieren.
Warum werden sie zu oft verschrieben?
Etwa 40 bis 60 Prozent der Antibiotika-Rezepte sind falsche Verordnungen, so Dr. Michael Kresken von der Paul-Ehrlich-Gesellschaft. In jedem zweiten Fall werden sie also ohne Grund verschrieben, meist bei harmlosen Infekten wie Schnupfen oder Husten. Der Grund: Viele Mediziner scheuen den Aufwand, den eine Blutuntersuchung oder ein Abstrich mit sich bringt. Sie verordnen prophylaktisch Antibiotika, ohne zu klären, welcher Erreger vorliegt und welches Antibiotikum am besten helfen würde.
Aber auch die Erwartungshaltung der Patienten verleitet viele Ärzte zur schnellen Verschreibung: Viele Patienten fordern die Antibiotika regelrecht ein, weil sie nicht ohne ein gut wirksames Medikament nach Hause gehen wollen.
Was können die Folgen des sorglosen Umgangs sein?
Schon heute wirken bei vielen Bakterien Antibiotika nicht mehr, weil die Erreger bereits resistent geworden sind. Im ambulanten Bereich geschieht dies am häufigsten, weil die Patienten ihre Medikamente nicht in ausreichender Dosierung oder nicht mit dem richtigen zeitlichen Abstand einnehmen. Viele setzen die Medikamente ab, sobald es ihnen besser geht. Das Problem: Widerstandsfähige Bakterien können überleben und werden gegen das Medikament unempfindlich. Dabei hilft ihnen die Tatsache, dass das Antibiotikum die Darmflora und die Schleimhäute bereits geschädigt hat und diese nun einen idealen Nährboden für die Ausbreitung der resistenten Keime darstellen.
Da die Bakterien gegen immer mehr Antibiotika resistent werden, sind wir darauf angewiesen, dass die Pharmaindustrie ständig neue Antibiotika entwickelt – ein Wettlauf mit der Zeit.
Ein besonders großes Problem stellen resistente Keime in Krankenhäusern dar.
Wie nimmt man Antibiotika richtig ein?
Ein paar wichtige Regeln zur Einnahme von Antibiotika sollte man unbedingt beachten:
Ein Antibiotikum sollte immer so lange und in der Dossierung eingenommen werden, wie es der Arzt verschrieben hat. Bei einem vorzeitigen Abbruch werden nicht alle Bakterien abgetötet, die noch vorhandenen können Resistenzen bilden.
Die vorgeschrieben Abstände zwischen den Einnahmen sollten eingehalten werden, um einen gleichmäßigen Pegel an Wirkstoffen zu gewährleisten. "Dreimal täglich" bedeutet also: alle acht Stunden eine Dosis.
Hat man eine Tablette vergessen, kommt es auf den zeitlichen Abstand bis zur nächsten Einnahme an, ob man die vergessene noch nachträglich nehmen muss. Genaue Angaben hierzu kann man der Packungsbeilage entnehmen.
Manche Antibiotika werden durch Kalzium in ihrer Wirkung gestört. Sie sollten deshalb nicht mit Milch oder kalziumreichen Mineralwässern eingenommen werden. Dasselbe gilt für Alkohol: Er schränkt die Wirksamkeit des Antibiotikums ein. Idealerweise nimmt man die Tabletten mit einem großen Glas Wasser ein. Zwischen dem Genuss von Milch/Milchprodukten und der Antibiotika-Einnahme sollten mindestens zwei Stunden liegen.
Einige Antibiotika müssen nüchtern eingenommen werden, andere zum Essen. Wann genau das individuelle Medikament eingenommen werden soll, darüber klären Arzt und Apotheker auf.
Wer noch andere Medikamente einnimmt, sollte wegen möglicher Wechselwirkungen mit seinem Arzt darüber sprechen.
Welche Nebenwirkungen gibt es?
In der Regel sind Antibiotika gut verträglich. Hauptnebenwirkungen sind Allergien, besonders häufig das so genannte Arzneimittelexanthem mit Hautausschlägen am ganzen Körper. Aber auch Störungen der Darmflora können vorkommen. Deshalb kann es zu weichen Stühlen und Durchfall kommen. Bei Frauen treten nach der Therapie häufig Pilzinfektionen auf.
Was kann man tun, um die Nebenwirkungen zu reduzieren?
Derzeit ist noch nicht genau erforscht, welche Langzeitwirkungen Antibiotika auf den Darm haben. Um die Darmflora schon während der Behandlung zu unterstützen, kann man auf spezielle Präparate aus der Apotheke zurückgreifen, z.B. Hefekulturen aus Saccharomyces boulardii oder Bakterienextrakte aus Lactobacillus rhamnosus. Zu diesen Präparaten gibt es positive Studienergebnisse (D'Souza AL, Rajkumar C, Cooke J et al. Probiotics in prevention of antibiotic associated diarrhoea: meta-analysis. BMJ 2002 [8. Juni]; 324: 1361-4).
Frauen, die nach einer Antibiotikagabe häufig unter Pilzinfektionen leiden, können Zäpfchen mit Milchsäurebakterien helfen, die Scheidenflora zu schützen.
Antibiotika und Alkohol
Kann man Antibiotika einnehmen und Alkohol trinken?

Antibiotika können schon nach wenigen Tagen zu einer deutlichen Verbesserung des Gesundheitszustands führen. Wenn sich ein Patient während der Therapie bereits fit und gesund fühlt, der Körper kaum Symptome zeigt, dann sind wieder normale Freizeitaktivitäten möglich. Aber gilt das auch für das Alkoholtrinken? Die Empfehlung fällt je nach Antibiotikum unterschiedlich aus und es kommt auf die Wirkung der Antibiotika an. Wir zeigen, welche Wirkung Alkohol und Antibiotika im menschlichen Körper entfalten und wann Sie Alkohol vermeiden sollten.
✓ Ärztliche Sprechstunde - Vertraulich & Professionell
✓ Rezeptversand direkt zu Ihnen
Was Alkohol im Körper bewirkt
Die direkten Folgen des Alkoholkonsums sind den meisten Menschen bekannt:
- Geringe Mengen wirken euphorisierend, enthemmend und anregend.
- Ab 0,5 Promille lassen Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit nach.
- Ab 0,8 Promille ist die Wahrnehmung beeinträchtigt, die Reaktionszeit stark verlängert und die Bewegungskoordination beginnt schlechter zu werden.
- Ab 1 Promille beginnt der sogenannte Rauschzustand mit Verwirrtheit, Sprach- und Orientierungsstörungen sowie Selbstüberschätzung. Auf einen Alkoholrausch kann ein Kater folgen. Man leidet dann unter Kopfschmerzen, Übelkeit, Magenschmerzen und Appetitlosigkeit.
- Ab 2 Promille zeigen sich ausgeprägte Gleichgewichts-, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen
- und ab 3 Promille beginnt das Bewusstsein einzutrüben. Außerdem ist die Atmung beeinträchtigt.
- Ab 4 Promille besteht die Gefahr, in ein Koma zu fallen und das Risiko eines Organversagens. Für den durchschnittlichen Alkoholkonsumenten ist dies die tödliche Dosis. Gewöhnung kann jedoch dazu führen, dass jemand mehr als 4 Promille verträgt.
Weit weniger bekannt sind die langfristigen Auswirkungen von Alkohol auf den Körper. Regelmäßiger Alkoholkonsum kann zu einer Entzündung der Leber führen, der sogenannten alkoholisch bedingten Fettleber Hepatitis (ASH). Im weiteren Verlauf führt diese zu einer sogennanten Leberzirrhose. Hierbei wird die Leber unumkehrbar in Bindegewebe umgebaut und verliert ihre Funktion. Eine Zirrhose geht oft einher mit Wasseransammlungen in der Bauchhöhle (Aszites), Hautveränderungen, einem Brustwachstum beim Mann (Gynäkomastie), Potenzstörungen sowie Krampfadern am Bauch, am Magen und in der Speiseröhre, die massiv bluten können.
Darüber hinaus kann langjähriger Alkoholkonsum zu Nervenschädigungen (Polyneuropathie) mit Gehstörungen und Nervenschmerzen führen sowie zu Entzündungen von Magen und Speiseröhre, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) und vermehrtem Auftreten von Krebs im Mund- und Rachenraum, in der Speiseröhre, im Magen, in der Bauchspeicheldrüse und in der Leber. Zusätzlich schädigt starker Alkoholkonsum das Herz, die Nervenzellen im Gehirn und stört die Aufnahme wichtiger Nährstoffen im Darm. Lesen Sie hier mehr zu den Auswirkungen von Alkohol.
Wirkweise von Antibiotika
Antibiotika können die Vermehrung von Bakterien hemmen oder Bakterien ganz zerstören. Sie werden bei bakteriell bedingten Erkältungen, Scharlach, Lungenentzündungen (bakteriell verursacht), Harnwegsinfekten (z.B. Blasenentzündungen oder Infektionen der Haut angewendet. Um eine Infektion vollständig zu bekämpfen, ist es wichtig, das verschriebene Antibiotikum bis zum Ende zu nehmen. Ansonsten können einzelne Bakterien überleben und Resistenzen ausbilden und die Wirksamkeit des Antibiotikums bei einer erneuten Infektion beeinträchtigen.
Bakterienzellen sind aus Proteinen aufgebaut. Antibiotika hemmen entweder die Vermehrung von Bakterien, indem sie die Proteinproduktion stören oder sie zerstören Bakterien durch direkte Schädigung der Zellwand oder Hemmung der Zellwandsynthese. Neben diesem erwünschten Effekt besitzen Antibiotika einige Nebenwirkungen. Diese unterscheiden sich bei den verschiedenen Antibiotika-Klassen:
- Penicilline (z.B. Penicillin G), welche z.B. bei einer Mandelentzündung eingesetzt werden können, führen z.B. zu allergischen Reaktionen, Übelkeit und Durchfällen. Vorsicht ist geboten, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist.
- Tetracycline (z.B. Doxycyclin), die teilweise bei Lungenentzündungen eingesetzt werden, können zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen und Leberschäden führen.
- Makrolide (z.B. Erythromycin) können ebenfalls zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen führen und können Herzrhytmusstörungen verursachen. Sie werden z.B. als Alternative zu Penicillinen verwendet und bei sexuell übertragbaren Krankheiten eingesetzt.
- Fluorchinolone (z.B.Ciprofloxacin bei Harnwegsinfekten) können zu Magen-Darm-Störungen, schweren Leberschäden und Herzrhytmusstörungen führen.
- Nitroimidazole (z.B. Metronidazol) können zu Magen-Darm-Störungen und neurologischen Schäden führen.
Der Zusammenhang von Alkohol und Antibiotika
Bei einer Therapie mit Antibiotika liegt eine bakterielle Infektion vor. Der Körper des Patienten ist dadurch erheblich angegriffen. Auch bei einer Besserung kämpft das Immunsystem noch gegen die Infektion an. Für die vollständige Genesung sind in dieser Phase Ruhe und Erholung nötig. Durch Alkoholkonsum wird der Körper jedoch angestrengt und zusätzlich geschwächt. Dadurch kann die Erkrankung wieder zurückkommen und schlimmer werden als zuvor. Der Alkoholkonsum während der Einnahme von Antibiotika ist daher grundsätzlich kritisch.
Zusätzlich zur Belastung des Körpers durch Alkohol gibt es Wechselwirkungen zwischen Alkohol und bestimmten Antibiotika. Besonders gefährlich ist der Konsum von Alkohol bei Einnahme von Metronidazol. Alkohol wird von dem Enzym Alkoholdehydrogenase (ADH) zu Acetaldehyd abgebaut, welches von dem Enzym Acetaldehyddehydrogenase (ALDH) zu Acetat abgebaut wird. ALDH wird von Metronidazol gehemmt. In der Folge fällt vermehrt Acetaldehyd an, was zu Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Atemnot, Herzrhytmusstörungen und Blutdruckabfall führen kann („Antabus-Effekt“). Deswegen sollte bei der Einnahme von Metronidazol (und Tinidazol) bis 3 Tage nach dem Ende der Therapie jeglicher Alkoholkonsum vermieden werden. Alkohol kann auch in einigen Mundspülungen oder anderen Medikamenten in Tropfenform enthalten sein.
Andere Antibiotika interagieren ebenfalls mit Alkohol. Cotrimoxazol kann in Kombination mit Alkohol zu den selben Symptomen wie Metronidazol führen. Doxycycline kombiniert mit Alkohol führen zu einer verminderten Wirksamkeit des Antibiotikums und können die Leber schädigen. Und der Effekt von Erythromycin wird durch Alkohol vermindert oder setzt verspätet ein.
Antibiotika werden entweder über die Leber oder die Niere verstoffwechselt. Alkohol wird über die Leber abgebaut. Die Auswirkungen von Alkohol auf die Leber können die Wirkung von allen Antibiotika, die über die Leber abgebaut werden, beeinflussen (z.B. Makrolide). Zusätzlich verstärkt Alkohol die Aktivität von Cytochrom P450 2E1 (ein Enzym in der Leber), wodurch die Effekte von anderen Medikamenten (z.B. Paracetamol) verstärkt oder vermindert werden können.
Die gute Nachricht zum Schluss: Cefuroxim, ein Antibiotikum aus der Gruppe der Cephalosporine (mit den Penicillinen verwandt), welches häufig verabreicht wird (u.a. bei Atemwegsinfekten), verträgt sich gut mit Alkohol.
Antibiotika und Alkohol können in manchen Fällen kombiniert werden
Ein allgemeines Alkoholverbot während einer Antibiotikatherapie ist falsch.Viele Präparate vertragen sich gut mit Alkohol. Bei einigen besteht jedoch das Risiko einer verminderten Wirksamkeit durch die Kombination mit Bier, Wein und Co. Nur bei der Einnahme von Metronidazol, Tinidazol und einigen Cephalosporinen darf kein Alkohol getrunken werden. Das gilt auch für Patienten, die Antibiotika nehmen und unter chronischen Leber- oder Nierenschäden leiden. Die Kombination mit Alkohol kann in diesen Fällen akut lebensbedrohlich sein. Im Zweifelsfall sollte Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten werden, um mögliche Wechselwirkungen abzuklären. Hilfreiche Daten und Fakten zu dem Thema finden sich in der Arzneimitteldatenbank des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information.
✓ Ärztliche Sprechstunde - Vertraulich & Professionell
✓ Rezeptversand direkt zu Ihnen


Reguliert durch die CQC 1-201500907

Mitglied der englischen Ärztekammer
Erstklassige Abwicklung! Seriös und vertrauensvoll!
Professionielle Beratung & Abwicklung. Prima Service, sehr schneller Versand. Keine komplizierte Zahlung per Kreditkarte, Vorauskasse o.ä. Lieferung auf Rechnung. Kurzum: Sehr empfehlenswert.
. perfekt & einwandfrei
. schnell, unkompliziert, wirklich gute Abwicklung und perfekter Ablauf - wie auf der Webseite beschrieben. Habe nichts zum meckern.
Unbürokratische Abwicklung! Bin begeistert.
Tolle Seite, wenn man keine Zeit hat zum Arzt zu gehen und sich ein Folgerezept zu holen. Werde öfter darauf zurückgreifen.
Bestellung bei DrEd.
DrEd.ist ein Onlinearzt wie man ihn in Deutschland vergebens sucht. Ich kann nur sagen "sehr gut". Habe das erste mal bei DrEd bestellt und war wie alle anderen Besteller etwas skeptisch wurde aber positiv überrascht weil, es kam was ich bestellt hatte und auch die Arztberatung war völlig in Ordnung. Auch Nachfragen beim DrED Ärzteteam werden online sofort beantwortet. Ich kann DrEd nur weiter empfehlen D.I.
Unkompliziert und schnell
Alles ging unkompliziert und schnell vonstatten. Das richtige, wenn man von vornherein weiß was man will.
Es ist alles prima gelaufen
Ich dachte dass dieses Portal ein Fake ist, aber alles ist wunderbar gelaufen. Kann ich nur empfehlen.
Vollauf zufrieden
Sehr gute Übersicht - alles gut zu finden - sehr schnelle Bearbeitung - bin super zufrieden .
Die Abwicklung erfolgte superschnell (Lieferung am nächsten Tag) und seriös.
Reibungslos und schnell!
Alles klappte wirklich einwandfrei und sehr schnell. Ich bekam einen gut verständlichen Arztbrief und fühlte mich vernünftig beraten. Auf Risiken wurde aufmerksam gemacht und mir wurden die zu mir passenden Dosierungen und Medikamente begründet empfohlen. Innerhalb von 2 Tagen hatte ich mein Medikament an der Wohnungstür. Mann kann auch nur das Rezept bestellen, aber ich wollte gleich alles, inkl. Apotheke erledigt haben, ohne selbst noch von Pontius bis zu Pilatus rennen zu müssen. UND. es hat ja auch wirklich alles perfekt geklappt! SEHR GERN WIEDER .
Einfach superklasse .
War eine richtig gute Erfahrung. Wenn man berufstätig ist und einfach keine Zeit für Öffnungszeiten und Sprechzeiten hat, ist das eine optimale Lösung. Hier bekommt man schnelle Hilfe und kann sich gut beraten lassen. Für mich jederzeit wieder. Dankeschön
Perfekte Abwicklung !
Der Vorgang war von der Diagnose bis zur Auslieferung des Medikaments rundum perfekt. Schnell, absolut pünktliche und völlig diskrete Lieferung. Die Leistungen von DrEd werde ich wieder in Anspruch nehmen.
Weitere Behandlungen
Weitere Informationen
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir versuchen ständig, DrEd zu verbessern und freuen uns über Ihre Fragen oder Anregungen. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht.





Health Bridge Limited (t/a DrEd), 3 Angel Square, 4th Floor, 1 Torrens Street,
Комментариев нет:
Отправить комментарий